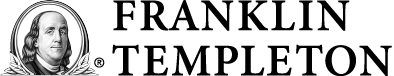AUTOREN

Matthias Hoppe
SVP/Head of EMEA Portfolio Management
Franklin Templeton Investment Solutions
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat bereits tragische Opfer gefordert, täglich sterben Menschen, ganze Städte und die Infrastruktur werden zerstört. Für die Weltwirtschaft ist die unmittelbare Auswirkung relativ klar: ein stärkerer und dauerhafterer Inflationsdruck.
Die ursprünglich durch die Pandemie ausgelösten Unterbrechungen der Versorgungs- und Lieferketten haben sich durch den Krieg verschärft. Die Inflationszahlen waren bereits vor dem Krieg hoch. Hatte man für dieses Jahr anfangs noch auf eine Normalisierung der Preisentwicklung gesetzt, macht der negative Angebotsschock bei Energie und landwirtschaftlichen Rohstoffen dieser Hoffnung einen Strich durch die Rechnung.
Die internationalen Sanktionen gegen Russland und die Kämpfe in der Ukraine führen zu verschiedenen Verwerfungen und beeinträchtigen die globalen Rohstoffmärkte in noch nie da gewesener Weise. Sektoren wie etwa Energie, Automobile, Halbleiter und Lebensmittel – um nur einige zu nennen – sehen sich einer Menge Probleme ausgesetzt.
Auf Russland entfallen zwar weniger als 2 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das Land spielt aber eine überragende Rolle auf den Rohstoffmärkten. So liefert Russland etwa 12% des weltweiten Rohöls und 17% des Erdgases. Die Europäische Union (EU) bezieht etwa 45 % des Erdgases aus Russland, dazu 40 % des Rohöls und der Raffinerieprodukte sowie 46 % der Kohleimporte.
Russland ist zudem ein wichtiger Lieferant von Metallen, die unter anderem für die Energiewende von zentraler Bedeutung sind: Nickelerz (11,3 %), Kupfer (6,5 %), Lithium (3,7 %) und Aluminium (3,3 %).
Zudem entfallen auf Russland und die Ukraine mit 29 % ein Großteil der weltweiten Weizeneinfuhren und fast 30 % des weltweiten Gerstenangebots. Die Ukraine liefert 46 % des Sonnenblumenöls und etwa 15 % des weltweiten Maisangebots. Russland allein liefert über 12 % der weltweiten Düngemittel.
Energie
Viele Länder versuchen, sich von russischen Energieimporten abzuwenden. Die Vereinigten Staaten können es sich leisten, ein vollständiges Verbot russischer Ölimporte zu erlassen. Sie werden wahrscheinlich eine der am wenigsten betroffenen Industrienationen sein. Das Risiko ist für die EU indes besonders hoch.
Die EU und allen voran Deutschland haben sich zwar verpflichtet, die Abhängigkeit zu reduzieren. Das wird aber mehrere Jahre dauern. Der deutsche Wirtschaftsminister reiste dazu im März in den Nahen Osten, um sich die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für die Zukunft zu sichern, die Gegenwart ist allerdings kompliziert: Die Kapazitäten für die Einfuhr von LNG sind in der EU begrenzt, Deutschland verfügt bekanntermaßen über noch kein einziges LNG-Terminal, um das Gas direkt zu empfangen.
Die LNG-Importe beliefen sich in der EU etwa in den ersten beiden Monaten dieses Jahres auf durchschnittlich 9 Mrd. Kubikmeter pro Monat. Analysten der Barclays Bank sind der Meinung, dass nur noch 1 bis 2 Mrd. Kubikmeter pro Monat zusätzlich möglich sind. Der Großteil der zusätzlich freien Kapazitäten zur Regasifizierung von LNG befindet sich in Spanien. Die Infrastruktur für den Transport nach Deutschland oder Polen ist schwierig und begrenzt.
Und auch die Ausfuhr von LNG aus den USA ist begrenzt. Der Aufbau weiterer LNG-Exportkapazitäten erfordert viel Zeit und Kapital. Zudem wird Europa Asien bei der Beschaffung von LNG preislich überbieten müssen, wenn es mehr Gas beziehen will, um für den nächsten Winter eine bessere Lagerposition zu haben.
Unter der Annahme, dass Russland die Erdgaslieferungen nach Europa nicht einschränkt, dürften die Preise angesichts der Notwendigkeit, die leeren Gasspeicher wieder aufzufüllen, weiterhin hoch bleiben. Ein einigermaßen milder Winter und ein gewisser marginaler Nachfragerückgang hat Europa vor dem schlimmsten Szenario (dass in diesem Winter das Gas ausgeht) bewahrt. Dennoch werden die Speicherstände am Ende dieses Jahres weiter am unteren Ende der historischen Spanne liegen.
Schon vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine rechneten die Terminmärkte für den nächsten und übernächsten Winter mit deutlich höheren Erdgaspreisen als im Frühjahr des vergangenen Jahres. Wenn Russland die Erdgaslieferungen nach Europa drosselt, könnten die Lagerbestände für den nächsten Winter sehr wohl schlechter sein als im vergangenen Jahr.
Die Konsequenz: Die Erdgas- und Strompreise bleiben in Europa unabhängig vom Ausgang des Krieges auf absehbare Zeit hoch – was sich negativ auf die Inflation und dann insbesondere auf das Wachstum auswirken wird. Während die privaten Verbraucher in einigen europäischen Ländern vor den hohen Strompreisen durch staatliche Eingriffe und Subventionen einigermaßen geschützt sind, sind die Unternehmen wahrscheinlich stärker betroffen.
Autos
Der Krieg hat in der durch Chipmangel und Lieferengpässe geplagten Automobilindustrie zu einer zusätzlichen Teileknappheit geführt. Die Ukraine ist zum Beispiel ein wichtiger Lieferant von Kabelbäumen, die für die Verbindung der verschiedenen Komponenten in einem Auto benötigt werden.
Russland wiederum ist der weltweit größte Exporteur von Palladium und der zweitgrößte Exporteur von Platin, die beide für den Bau von Katalysatoren verwendet werden.
Halbleiter
Palladium wird auch in bestimmten Arten von Computerspeichern verwendet. Schon vor dem Krieg hatte die Autoindustrie mit der Knappheit von Halbleitern zu kämpfen.
Die bereits erschöpften Chip-Lagerbestände wieder aufzufüllen, wird nun zusätzlich erschwert. Russland und die Ukraine produzieren zudem 40 bis 50 % des Neongases, welches für die Herstellung von Halbleitern verwendet wird. Die Schließung der Schwarzmeerhäfen, über die die vorhandenen Neongasvorräte in die Welt transportiert werden, verschlimmert die Versorgungslage.
Lebensmittel
Auch wird das Getreide über diese Häfen in die Welt verschifft. Die wichtigsten Handelspartner der Ukraine für Agrarrohstoffe sind der Nahe Osten und Nordafrika. Diese Regionen werden von kriegsbedingten Unterbrechungen der Versorgung mit Mais und Weizen am stärksten betroffen sein, und zwar nicht nur aktuell.
Das Aussähen von Mais, Gerste und Sonnenblumen beginnt in der Regel im April, und in der Ukraine in den Gebieten, in denen das russische Militär derzeit Stellung bezieht. Dadurch sind sowohl die Aussaat als auch die Ernte dieses Jahr gefährdet.
Woanders auf der Welt sind Landwirte auf Dünger aus Russland angewiesen. Die Sanktionen erschweren die Ausfuhr, aber auch Russland hat als Vergeltung eine weitgehende Aussetzung der Düngemittelausfuhren angeordnet. Die Gefahr einer anhaltenden Düngerknappheit könnte die landwirtschaftlichen Kosten erhöhen und die Ernteerträge verringern – was zu einer weltweiten Nahrungsmittelinflation führen könnte.
Makroökonomischer Ausblick
Die Auswirkungen des Krieges bescheren den Volkswirtschaften weltweit somit einige Schwierigkeiten. Und auch die Zentralbanken stehen vor einer Herausforderung. Die makroökonomischen Aussichten haben sich jedenfalls eingetrübt, die Inflationserwartungen drastisch erhöht. Die Schar der von Bloomberg befragten Ökonomen sieht zwar noch keine Rezession für dieses Jahr, sondern immer noch robustes Wachstum von 2 % für die Eurozone und 2,3 % für die USA – die Risiken sind allerdings gestiegen.
Die negativen Auswirkungen auf das Wachstum in den USA dürften noch relativ moderat sein, weil die Abhängigkeit von russischer Energie anders als in Europa vernachlässigbar ist. Mit einer Beeinträchtigung des Unternehmens- und Konsumentenvertrauens ist bei anhaltend hohen Preisen dennoch zu rechnen.
Europa wird aufgrund seiner starken Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland stärker betroffen sein. Das Vertrauen der deutschen Wirtschaft ist bereits auf den niedrigsten Stand seit den ersten Monaten der Pandemie gesunken, nachdem der Krieg die Aussichten eingetrübt und die Energiepreise in die Höhe getrieben hat: Die vom Münchner ifo Institut ermittelten Geschäftserwartungen fielen im März auf 85,1 von 98,4 im Februar – der schlechteste Wert seit Mai 2020.
Das Risiko einer Stagflation (Rezession bei gleichzeitiger Inflation) in der Eurozone ist gestiegen. In der Vergangenheit hat ein starker Anstieg des Preises für Rohöl mit etwas Verzögerung zu einer Rezession geführt.
Der Inflationsanstieg ist angebotsbedingt und daher erwarten wir, dass sich der Preisanstieg negativ auf die Nachfrage der Haushalte und Unternehmen auswirken wird. Die Mischung aus höherer Inflation und geringerer Nachfrage trägt zu einem für die Zentralbanken prekären Umfeld bei. Sie stehen vor einem Dilemma: Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, und gleichzeitig die Konjunktur abwürgen?
Es wird erwartet, dass die Zentralbanken in den meisten großen Regionen ihre Zinssätze in diesem Jahr erhöhen werden, in einigen Fällen sogar deutlich. Die Federal Reserve (Fed) in den USA hat bereits signalisiert, an weiteren sechs Zinserhöhungen bis Jahresende festzuhalten. Verglichen mit dem Ausmaß der Inflation in den USA ist die Haltung der Fed jedoch bei weitem nicht so restriktiv, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Heute liegt der US-Leitzins nur knapp über null, während die Gesamtinflation des Verbraucherpreisindex (CPI) bei fast 8 % liegt und die von der Fed bevorzugte Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (PCE) bei 5,2 % steht. Die Markterwartungen preisen für Dezember 2022 einen Leitzins von etwa 2 % ein, die mittlere Prognose des Offenmarktausschusses liegt bei 1,875 %. In früheren Zinserhöhungszyklen musste die Fed den Leitzins über die Inflation anheben, um die Preisdynamik wieder unter Kontrolle zu bringen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) jedenfalls dürfte ihre Pläne zur Rücknahme der geldpolitischen Stimuli aufschieben. Für die politischen Entscheidungsträger wird es schwierig sein, in diesem volatilen makroökonomischen Umfeld eine „weiche Landung“ der Konjunktur zu erreichen. Die Fiskalpolitik bleibt zumindest expansiv – sogar in Deutschland.
Implikationen für Portfolios
Auch Anleger werden die komplexen Auswirkungen durchdenken und ihre Portfolios entsprechend positionieren müssen. Auch wenn die aktuelle Unsicherheit für Volatilität sorgt, raten wir Anlegern, die langfristige Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren: Längerfristig dürften globale Aktien immer noch ein größeres Performancepotenzial haben als globale Anleihen.
In unseren Multi-Asset-Portfolios sind wir heute zwar auf mittlere Sicht weniger optimistisch für Aktien als noch am Jahresende. Insbesondere für Aktien aus der Eurozone, wo die Auswirkungen der Versorgungsketten am stärksten sind, haben wir eine eher pessimistische Haltung eingenommen. Allerdings sind im aktuellen Umfeld Staatsanleihen durch Inflation und steigende Zinsen kein „sicherer Hafen“. Gerade in diesem Umfeld ist Diversifikation die Maxime.
So dürfte das Wachstum in den USA besser ausfallen als in anderen Industrieländern, was auf die fiskalischen Anreize der Vergangenheit und die gesunden Bilanzen der Verbraucher zurückzuführen ist. Das sollte für den Aktienmarkt dort positiv sein. Außerdem bietet der US-Aktienmarkt in Zeiten erhöhter globaler Risiken in der Regel gewisse defensive Eigenschaften, die in dieser Zeit besonders attraktiv sein könnten.
Gegenüber China sowie anderen Schwellenländer-Aktienmärkten bleiben wir hingegen vorsichtig. Im vergangenen Jahr hat sich das chinesische Wachstum im Vergleich zum Rest der Welt abgeschwächt. Die Wirtschaft wurde nur zögerlich unterstützt, da die Regierung mit Herausforderungen im Immobiliensektor konfrontiert war und eine strenge Regulierung durchführte, um ihr Ziel des gemeinsamen Wohlstands zu erreichen. Auch wenn die Politik inzwischen zu einer lockeren Haltung übergegangen ist, wirken diese Maßnahmen immer noch nach. Der frühere Rückgang des Kreditwachstums und die „Null-Covid-Politik“ wirken weiterhin negativ auf den Unternehmenssektor, die Produktion und die Lieferketten. Und: Der Handelskonflikt mit den USA ist nach wie vor ungelöst und Grund allgemeiner Spannungen. Durch den Ukrainekrieg und Chinas Haltung werden diese Spannungen nicht besser.
Die längerfristigen Aussichten für andere Schwellenländer, insbesondere die rohstoffreichen Länder Lateinamerikas, haben sich dagegen etwas aufgehellt.
Die lokalen Zinssätze sind im vergangenen Jahr stark angestiegen und könnten sich dem Höchststand nähern. Die Bewertungen sind im Vergleich zu anderen Schwellen- und Industrieländern nach wie vor attraktiv.
Und Anleihen? Wir bevorzugen im aktuellen Umfeld und nach dem Renditeanstieg der vergangenen Wochen weiterhin Unternehmensanleihen vor Staatsanleihen. Das Renditepotenzial von Staatsanleihen dürfte aufgrund des Renditeniveaus, der Inflation und der restriktiveren Geldpolitik weiterhin gering sein.
Aber: Die potenziellen Diversifizierungsvorteile der Anlageklasse in einem Multi-Asset-Portfolio bleiben bestehen. Zum Beispiel schossen Anfang März die Renditen zeitweise nach unten und die Preise nach oben – und pufferten Verluste an den Aktienmärkten teilweise ab. Das zeigt aber auch, dass ein flexibler und aktiver Portfolioansatz mehr denn je gefragt ist.