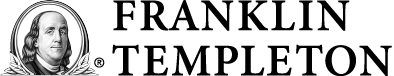AUTOREN

Nick Langley
Managing Director, Portfolio Manager
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Wesentliche Veränderungen in den Wirtschaftssektoren im Zuge der Energiewende werden erhebliche Auswirkungen auf längerfristig orientierte Portfolios haben und ein Bewusstsein für das Risiko-Rendite-Verhältnis von Allokationen erfordern, die einen Bezug zu diesen Veränderungen aufweisen.
- Die politischen Risiken im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten werden sich in unterschiedlichem Maße auf die Wertschöpfungskette des Stromsektors sowie die darin agierenden Anleger auswirken.
- Während die Finanzierung der Energiewende, welche die Lebenshaltungskostenkrise verschärfen dürfte, einen Renditerückgang in den subventionsabhängigen Segmenten der Strom-Wertschöpfungskette nach sich ziehen könnte, gehen wir davon aus, dass die regulatorische Landschaft den regulierten Versorgungsunternehmen weiterhin attraktive Renditen bescheren wird.
Die Energiewende und die Dekarbonisierung schreiten weiter voran und gehen mit wesentlichen Veränderungen in Sektoren wie Energie, Strom und Transport einher. Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge müssen die Emissionen im Stromsektor durch den Ausbau von Solar- und Windkraft und die Stilllegung von Kohlekraftwerken gesenkt werden, damit bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreicht werden können.1 Die Stromversorgung aus Solar- und Windkraft dürfte um 27 % bis 60 % steigen, während die Zunahme erneuerbarer Energien die Kohlenstoffintensität der Stromerzeugung um 60 % verringern wird.2
Entsprechend werden sich die Investitionen in den Stromsektor verdreifachen, wobei über die Hälfte davon auf erneuerbare Energien und ein Drittel auf die Modernisierung der Stromnetze entfallen dürfte. Darüber hinaus werden 65 % aller pro Jahr verkauften Autos Elektrofahrzeuge sein. Was den Strombedarf anbelangt, so benötigen zwei Elektrofahrzeuge genauso viel Strom wie ein neu an das Stromnetz angeschlossenes Haus. Dieses Wachstum bei Elektrofahrzeugen wird beachtliche Ausgaben für Masten, Leitungen und Umspannstationen in den Straßen unserer Großstädte nach sich ziehen, um den erhöhten Strombedarf für das Laden zu decken.
All diese Veränderungen haben erhebliche Auswirkungen auf Anleger mit längerfristig orientierten Portfolios und erfordern ein Bewusstsein für das Risiko-Rendite-Verhältnis von Allokationen, die einen Bezug zu diesen Veränderungen aufweisen. Unserer Meinung nach stellen regulierte Versorgungsunternehmen mit Blick auf die risikobereinigte Rendite den besten Sektor für ein Engagement in der Energiewende dar.
Öffentliche Politik und Finanzierung der Energiewende
Viele der oben angesprochenen Veränderungen sind durch die Politik bedingt, die eine Verlagerung der Energieerzeugung für die Wirtschaft von Öl und Gas hin zu Elektrizität anstrebt und das Netz dann so weit wie möglich mit erneuerbarer Energie betreiben will. Die Regierungen haben sich ambitionierte Ziele gesetzt, so etwa der REPowerEU-Plan, der eine Steigerung der Solarkraftkapazitäten von derzeit rund 200 GW auf 750 GW bis 2030 anstrebt.3 Andere wichtige politische Entwicklungen, die sich auf die Anleger auswirken, sind der US Inflation Reduction Act (IRA), der Green Deal Industrial Plan der Europäischen Union (EU) sowie das britische Programm „Powering Up Britain“ (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Wichtige politische Maßnahmen in Bezug auf die Energiewende nach Region

Stand: 31. Dezember 2023. Quelle: Weißes Haus, Europäische Kommission, britisches Parlament und ClearBridge Investments.
Die politische Vorgehensweise wird darin bestehen, bestimmte Technologien mit Steuergeldern zu subventionieren, um Investitionen in erneuerbare Energien zu fördern und die Genehmigungsverfahren für Entscheidungen in Bezug auf die Umwelt und Standorte zu vereinfachen, damit Projekte zügig realisiert werden können. Diesbezüglich bestehen verschiedene Ansätze. Der Privatsektor kann eingebunden werden und die Anfangskosten tragen. Diese Investitionen müssen aber eine Rendite abwerfen, was in Zukunft höhere Stromrechnungen zur Folge haben wird.
Staatliche Subventionen, wie sie etwa vom IRA und dem Green Deal der EU vorgesehen sind, stellen eine weitere Möglichkeit dar und können den Anstieg der Stromrechnungen abschwächen. Alternativ könnten die Regierungen die Investitionen selbst leisten. Es ist damit zu rechnen, dass die Regierungen rund um den Globus eine Vielzahl von Ansätzen verfolgen werden (vgl. Abbildung 2), die jeweils auf ihre spezifischen Ressourcen, Anforderungen und Beschränkungen zugeschnitten sind.
Abbildung 2: Die Finanzierung der Energiewende gestaltet sich schwierig

Quelle: ClearBridge Investments.
Dies hat jedoch seine Konsequenzen, denn die Staatsausgaben – seien es nun Subventionen oder Vorabinvestitionen – müssen irgendwie finanziert werden. Erreichen können die Regierungen dies entweder durch höhere Steuern oder durch höhere Haushaltsdefizite. Beide Vorgehensweisen bleiben nicht ohne Folgen für die Privathaushalte. Höhere Steuern verringern das verfügbare Einkommen der Privathaushalte, während höhere Haushaltsdefizite – die vermutlich über den Anleihenmarkt finanziert würden, wo umfangreichere Emissionen einen Anstieg der Staatsanleihenrenditen zur Folge haben dürften, – höhere Hypotheken- sowie damit verbundene Kosten für Verbraucherkredite nach sich ziehen würden. Die Haushaltsdefizite könnten auch über die Zentralbanken in Form einer quantitativen Lockerung oder einer Kontrolle der Zinskurve finanziert werden, wenngleich dies in letzter Zeit zu Preisauftrieb und einer globalen Lebenshaltungskostenkrise geführt hat.
Während der Zuspruch für grüne Politik seitens jüngerer Bevölkerungsgruppe im Allgemeinen Gutes für die Energiewende und die Bekämpfung des Klimawandels verheißt, stellen die Lebenshaltungskosten weiterhin ein wesentliches Problem dar, das durch Staatsausgaben noch verschärft wird. Die höheren Lebenshaltungskosten könnten in Zukunft selbst jüngere Wähler davon abhalten, sich für eine staatliche Finanzierung der Energiewende auszusprechen, da sie den Druck auf die Lebenshaltungskosten gerade dann zu spüren bekommen, wenn sie einen eigenen Haushalt gründen und Kinder bekommen. Dies könnte die staatliche Finanzierung oder Subventionen gefährden.
Hier sind Anleger mit längerfristig orientierten Portfolios jedoch einem höheren Risiko ausgesetzt, wenn davon ausgegangen wird, dass die aktuelle oder bevorstehende Anlagelandschaft auf lange Sicht Bestand haben wird.
Die Strom-Wertschöpfungskette und das politische Risiko
Die Strom-Wertschöpfungskette erstreckt sich von der Erzeugung (z. B. Solar- und Windkraftparks, Gasturbinen) über die Übertragung (Hochspannungsmasten) bis hin zur Verteilung (Strommasten) an Privathaushalte oder Endverbraucher. Entsprechend sind in den verschiedenen Segmenten unterschiedliche Arten von Anlegern engagiert (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3: Strom-Wertschöpfungskette

Quelle: ClearBridge Investments, Bloomberg Finance.
Die politischen Risiken im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten werden sich in unterschiedlichem Maße auf die Wertschöpfungskette des Stromsektors sowie die darin agierenden Anleger auswirken. Mehr als die Hälfte aller im Jahr 2022 im Bereich der privaten Infrastruktur aufgenommenen Mittel wurde mit dem Label „erneuerbare Energien“ versehen. Dies bedeutet, dass ein erheblicher Teil des privaten oder nicht börsennotierten Infrastrukturkapitals in das Erzeugungssegment der Strom-Wertschöpfungskette investiert wird. An das Erzeugungssegment fließen auch die meisten Subventionen für den Kapazitätsausbau bei erneuerbaren Energien. Dieses ist unseres Erachtens einem höheren Risiko politischen Widerstands ausgesetzt, wenn der Druck auf die Lebenshaltungskosten infolge der Finanzierung der Energiewende steigt.
Das Strom-Anlageuniversum von ClearBridge setzt sich dagegen beispielsweise hauptsächlich aus regulierten Versorgungsunternehmen (85 %), die Vermögenswerte über die gesamte Wertschöpfungskette (Erzeugung, Übertragung und Verteilung) hinweg aufweisen, sowie einigen unregulierten Stromerzeugern (15 %) zusammen, deren Umsatz durch langfristige Stromlieferverträge gesichert ist.
Regulierte Versorgungsunternehmen mit besserem langfristigen Risiko-Rendite-Profil als Erzeuger
Neues Kapital wird indes in der gesamten Strom-Wertschöpfungskette benötigt, wobei die IEA den Finanzierungsaufwand bis 2030 auf 2,5 Billionen USD pro Jahr (zum Dollarkurs 2019) schätzt. Das überwiegend privat finanzierte Erzeugungssegment sieht sich einem erhöhten Risiko eines Mittelabzugs gegenüber, da die Subventionen, die dessen Ausbau derzeit vorantreiben, infolge der politischen Reaktion auf die steigenden Lebenshaltungskosten gekürzt werden könnten. Dagegen scheinen die Anlegerrenditen bei regulierten Unternehmen entlang der Strom-Wertschöpfungskette, oder allgemeiner bei börsennotierten Infrastrukturwerten, wesentlich sicherer zu sein, denn deren Renditen entsprechen im Laufe der Zeit tendenziell der von der Aufsichtsbehörde zugelassenen Eigenkapitalrendite (ROE) (vgl. Abbildung 4).
Dies ist auf die Merkmale regulierter Vermögenswerte zurückzuführen, bei denen die Erträge normalerweise durch eine von der Aufsichtsbehörde zugelassene Eigenkapitalrendite auf eine zugrundeliegende Vermögensbasis bestimmt werden, die wiederum vom Investitionsniveau abhängt.
Abbildung 4: Regulierte zulässige Renditen, ausgewiesene Eigenkapitalrenditen und Anlegerrenditen: Nordamerikanische Versorgungsunternehmen

Stand: 31. Dezember 2023. Quelle: ClearBridge Investments, Bloomberg Finance. Bei den Renditen handelt es sich um nominale Renditen nach Steuern, die sich aus den regulierten zulässigen Renditen ergeben, verglichen mit den von börsennotierten Unternehmen gemeldeten Eigenkapitalrenditen und den Gesamtrenditen (Einkommen und Kapital), die die Anleger erhalten haben. * DuPont ROE = Nettoeinkommen/Sachanlagen x Kennzahl für den Verschuldungsgrad, alle von Bloomberg berichteten Messwerte.
Während die Finanzierung der Energiewende, welche die Lebenshaltungskostenkrise verschärfen dürfte, einen Renditerückgang in den subventionsabhängigen Segmenten der Strom-Wertschöpfungskette nach sich ziehen könnte, gehen wir davon aus, dass die regulatorische Landschaft den regulierten Versorgungsunternehmen weiterhin attraktive Renditen bescheren wird. Dies spricht für ein Engagement bei börsennotierten Infrastrukturwerten, das überdies für ausreichend Liquidität sorgt, um die Positionierung an einem Markt anzupassen, der sich dynamischer entwickeln dürfte als von vielen angenommen. Überdies müssen sich die Anleger der Möglichkeit bewusst sein, dass einige Vermögenswerte zu „Stranded Assets“ werden könnten.
Da börsennotierte Infrastrukturwerte wie regulierte Versorgungsunternehmen geringeren politischen Risiken ausgesetzt sind, stellen diese Vermögenswerte unserer Meinung nach aus risikobereinigter Sicht eine bevorzugte Möglichkeit dar, sich an der voranschreitenden Energiewende zu beteiligen.
Fußnoten
-
Quelle: IEA, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, Mai 2021.
-
Ebd.
-
Quelle: Europäische Kommission, REPowerEU with Clean Energy, Mai 2022.
Definitionen
Die Internationale Energieagentur (IEA) ist eine in Paris ansässige autonome zwischenstaatliche Organisation, die 1974 errichtet wurde und politische Empfehlungen ausspricht. Sie arbeitet mit Regierungen und Branchenvertretern zusammen, um eine sichere und nachhaltige Energiezukunft für alle zu gewährleisten.
Der Inflation Reduction Act wurde am 16. August 2022 von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet. Das Gesetz zielt darauf ab, die Inflation durch Verringerung des Defizits einzudämmen, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken und in die heimische Energieerzeugung zu investieren. Gleichzeitig soll saubere Energie gefördert werden.
REPowerEU ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission zur Beseitigung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland vor 2030 als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022.
Der Green Deal Industrial Plan bietet einen Rahmen zur Unterstützung der Umstellung der europäischen Industrie hin zu Klimaneutralität und zur Entwicklung der Netto-Null-Technologien, die für die Erreichung der Klimaziele der Europäischen Union erforderlich sind.
„Powering Up Britain“ ist der Fahrplan der britischen Regierung für die künftige Energieversorgung in diesem Land. Das Programm vereint den aktuellen Energy Security Plan und den Net Zero Growth Plan und legt dabei dar, wie das Land die Energieerzeugung mittels Investitionen in erneuerbare Energien und Kernenergie zu diversifizieren, zu dekarbonisieren und ins Inland zu verlagern gedenkt.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Bitte beachten Sie, dass ein Anleger nicht direkt in einen Index investieren kann. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Renditen nicht gemanagter Indizes nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar.
Beteiligungspapiere unterliegen Kursschwankungen und sind mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden.
Festverzinsliche Wertpapiere sind mit Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie mit dem Risiko eines möglichen Verlusts des Kapitalbetrags verbunden. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren.
Internationale Anlagen sind mit besonderen Risiken verbunden. Hierzu gehören Währungsschwankungen, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten, die zu erhöhter Volatilität führen können. Diese Risiken sind in Schwellenländern noch größer.
Rohstoffe und Währungen sind mit erhöhten Risiken verbunden, zu denen unter anderem Marktrisiken und politische Risiken, das Regulierungsrisiko sowie Risiken im Zusammenhang mit naturgegebenen Bedingungen gehören, sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind.
Diversifizierung ist keine Garantie für Gewinne und bietet keinen Schutz vor Verlusten.
Unternehmen im Infrastruktursektor können einer Vielzahl von Faktoren ausgesetzt sein, darunter hohe Zinskosten, hohe Verschuldung, die Auswirkungen von Konjunkturabschwüngen, verschärfter Wettbewerb und die Auswirkungen staatlicher und regulatorischer Maßnahmen und Praktiken.
US-Staatsanleihen (Treasurys) sind direkte Schuldverschreibungen, die von der US-Regierung begeben werden und durch ihre uneingeschränkte Kreditwürdigkeit und Steuerhoheit abgesichert sind. Die US-Regierung garantiert die Kapital- und Zinszahlungen auf US-Staatsanleihen, wenn die Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Im Gegensatz zu US-Staatsanleihen sind Schuldtitel, die von Bundesbehörden und Gebietskörperschaften begeben werden, sowie damit verbundene Anlagen nicht unbedingt durch die uneingeschränkte Kreditwürdigkeit und Steuerhoheit der US-Regierung abgesichert. Selbst wenn die US-Regierung die Kapital- und Zinszahlungen auf Wertpapiere garantiert, betrifft diese Garantie keine Verluste, die auf einen Rückgang des Marktwerts dieser Wertpapiere zurückzuführen sind.
Alle Unternehmen und/oder Anwendungsfälle im vorliegenden Dokument dienen lediglich der Veranschaulichung. Eine entsprechende Anlage wird derzeit nicht unbedingt in einem von Franklin Templeton empfohlenen Portfolio gehalten. Die bereitgestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch eine individuelle Anlageberatung in Bezug auf bestimmte Wertpapiere, Strategien oder Anlageprodukte dar und sind kein Hinweis auf die Handelsabsichten für ein von Franklin Templeton verwaltetes Portfolio.