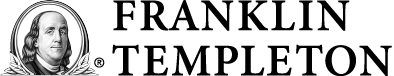AUTOREN

Sonal Desai, Ph.D.
Chief Investment Officer, Franklin Templeton Fixed Income
Wir befinden uns im Hinblick auf den Handelskrieg an einem wichtigen Scheidepunkt, da die Vereinigten Staaten vorläufige Abkommen mit Japan und der Europäischen Union (EU) geschlossen haben. In beiden Fällen werden die USA einen Basiszoll in Höhe von 15 % erheben – es wird aber Ausnahmen und möglicherweise verschiedene Zollsätze für bestimmte Produkte geben.
Die EU ist der wichtigste Handelspartner der USA; auf die Region entfällt beinahe ein Fünftel der US-Importe. Japan positioniert sich in dieser Hinsicht mit 5 % der Importe an fünfter Stelle. Diese Vereinbarungen folgen auf jene, die mit dem Vereinigten Königreich (2 %), Vietnam (4 %), Indonesien (1 %) und den Philippinen (0,4 %) geschlossen wurden. Von den großen Handelspartnern fehlen noch China, Kanada und Mexiko, die zusammen 42 % der US-Importe ausmachen. Während die Fortschritte vor gerade Mal zwei Wochen noch vernachlässigbar erschienen, so scheint die US-Regierung ihr Ziel, die Handelsbeziehungen mit ihren Partnern neu auszuhandeln, nun deutlich stärker vorangetrieben zu haben.
Daher ist nun ein guter Zeitpunkt, um die aktuelle Entwicklung zu beleuchten:
Der meiner Ansicht nach am meisten unterschätzte Punkt betrifft die Tatsache, dass die Zölle potenziell für enorme zusätzliche Einnahmen sorgen könnten. Wie vor drei Monaten in meinem Beitrag Meine Gedanken zur aktuellen Lage: T-Day – Tag der Zölle angemerkt, stellen Zölle eine Art Steuer dar, und mittlerweile lassen sich deren voraussichtliche Auswirkungen auf die öffentliche Finanzlage und die Wirtschaftstätigkeit besser abschätzen. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Zölle Einnahmen in Höhe von rund 130 Milliarden US-Dollar generiert (im Vergleich zu knapp über 50 Milliarden USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum).1
Brutto-Zolleinnahmen von rund 130 Mrd. USD in den ersten sieben Monaten des Jahres 2025
2018–2025

Quellen: US-Finanzministerium, Macrobond. Analyse von Franklin Templeton Fixed Income Research. Stand: 4. August 2025.
Wie könnte sich ein neuer Status quo gestalten? Die Verhandlungen sind noch im Gange, aber um eine grobe Vorstellung zu erhalten, lassen Sie uns davon ausgehen, dass letzten Endes Pauschalzölle in Höhe von 15 % erhoben werden – ähnlich wie bei den jüngsten Abkommen mit der EU und Japan. Im Jahr 2024 belief sich der Umfang der Importe auf 3,3 Billionen US-Dollar. Nehmen wir einmal an, dass sie auf diesem Niveau verharren. Dann lassen Sie uns außerdem die Annahme unterstellen, dass 1 Billion US-Dollar an Importen nicht mit Zöllen belegt werden – sei es, da sie unter das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada fallen, oder dank Ad-hoc-Ausnahmen. Zölle in Höhe von 15 % auf die verbleibenden Importe im Umfang von 2,3 Billionen US-Dollar hätten demnach Einnahmen in Höhe von 340 Milliarden US-Dollar zur Folge, was sich in etwa mit den jüngsten Daten zu den Zolleinnahmen deckt.
Dies sind 260 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen über den Durchschnitt aus den vergangenen drei Jahren hinaus – das entspricht einer Steuererhöhung im Umfang von beinahe einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dies würde dazu beitragen, das Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren auf etwa 5-6 % zu drücken (im Vergleich zu aktuellen Prognosen, die von 6-7 % des BIP ausgehen).2
Über einen Zeitraum von zehn Jahren würden sich die zusätzlichen Einnahmen auf rund 2,6 Billionen US-Dollar belaufen, was laut Schätzungen des Congressional Budget Office (CBO) in etwa dem kumulierten Anstieg des Primärdefizits um 2,4 Billionen US-Dollar infolge des Big Beautiful Bill (BBB) entspricht.3
Nun wird die Sache allmählich interessant: Durch die Verlängerung der 2017 durch den Tax Cuts and Jobs Act vorgenommenen Steuersenkungen „verzichtete“ der BBB dem CBO zufolge auf potenzielle Einnahmen in Höhe von 3,7 Billionen US-Dollar. Dies wurde zum Teil durch Ausgabenkürzungen im Umfang von 1,3 Billionen US-Dollar ausgeglichen. Es hat den Anschein, dass der Rest durch eine Erhöhung der indirekten Steuern ausgeglichen werden könnte – denn bei den Importzöllen handelt es sich effektiv um eine Umsatzsteuer. Die Fiskalpolitik gestaltet sich weiterhin entgegenkommend, wenn auch etwas weniger als zuvor. Im Vergleich zur bestehenden Politik kommt es dadurch zu einer Steuererhöhung, die allerdings indirekte Steuern (auf den Verkauf von importierten Gütern) und nicht direkte Steuern (Einkommens- und Körperschaftssteuern) betrifft.
Wie hoch fällt diese Steuererhöhung aus? Die gesamten Zolleinnahmen würden einer Umsatzsteuer in Höhe von 5 % auf alle Güter entsprechen (der Güterkonsum belief sich 2024 auf etwa 6,2 Billionen US-Dollar bei einem Gesamtvolumen an Waren und Dienstleistungen von beinahe 20 Billionen US-Dollar). Bedeutsam, aber nicht dramatisch ist in diesem Zusammenhang, dass der Großteil der EU-Länder eine Mehrwertsteuer (MwSt.) in Höhe von rund 20-22 % auf die meisten Waren und Dienstleistungen erhoben hat.
Die Ökonomen sind sich einig, dass indirekte Steuern allgemein besser sind als direkte Steuern: Sie decken einen breiteren Bereich ab, sind einfacher zu verwalten und zu vereinnahmen und sorgen nicht für eine Verzerrung der Arbeitsanreize (sie wirken jedoch regressiv, da einkommensschwächere Haushalte einen größeren Anteil ihres Einkommens ausgeben und somit im Vergleich stärker betroffen sind).
Zölle sind eine Umsatzsteuer, die im Inland hergestellte Waren begünstigt. Innerhalb der einzelnen europäischen Länder unterscheidet die Mehrwertsteuer aber auch zwischen bestimmten Waren und Dienstleistungen (beispielsweise Lebensmittel, Medikamente, Bücher), die mit niedrigeren Sätzen oder gar nicht besteuert werden.
Es zeichnet sich eine heimliche Verlagerung hin zu indirekten Steuern ab, die aus zwei Gründen unbemerkt bleibt: Zum einen hat das CBO die Auswirkungen der Zollerhöhungen außer Acht gelassen, sodass diese gar nicht erst in die Haushaltsdebatte eingeflossen sind. Der zweite Punkt ist das nicht ganz nachvollziehbare Argument der Regierung, dass die Zölle von ausländischen Produzenten gezahlt werden.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Zolllast zu mindestens drei Vierteln auf den Unternehmen und Haushalten in den USA liegen. In einigen Fällen werden die ausländischen Hersteller wohl die Preise senken, um Marktanteile zu behalten, wie es beispielsweise japanische Automobilhersteller in den vergangenen Monaten getan haben. Derartige Fälle von „Besteuerung ohne Gegenleistung“ dürften aber die Seltenheit darstellen und möglicherweise nur vorübergehender Natur sein. Bislang haben die US-Unternehmen den Großteil der Steuererhöhung durch eine Verringerung ihrer Gewinnmargen aufgefangen. Sobald die Handelsabkommen abgeschlossen sind, dürfte es zu umfassenderen Verbraucherpreiserhöhungen kommen. Dies würde die Inflation vorübergehend und leicht ankurbeln und dürfte das BIP-Wachstum etwas bremsen, was sich bereits in den Konjunktur- und den Daten zum Stellenaufbau abzeichnet. Möchte man aber die negativen Effekte einer indirekten Steuer auf das Wachstum minimieren, dann sind Zölle auf Einfuhren das Instrument der Wahl, denn der Nachfragerückgang würde sich überproportional stark auf Importe auswirken, die nicht direkt zum BIP-Wachstum beitragen.
Was bedeutet das für den Ausblick?
- Wir rechnen mit einem moderaten Abwärtsrisiko für das Wachstum, wenngleich sich die Auswirkungen in Grenzen halten dürfen. Und angesichts eines Haushaltsdefizits von 5-6 % des BIP gestaltet sich die Fiskalpolitik weiter expansiv. Für zusätzliche Belastung könnten eventuelle Handelsstörungen im Zuge der Anpassung der Lieferketten sorgen.
- Die Aufgabe der US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) verkompliziert sich. Die deutlichen Abwärtsrevisionen der jüngsten Arbeitsmarktdaten bestätigen eine gewisse Abschwächung am Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote bewegt sich jedoch weiterhin auf demselben niedrigen Niveau wie vor einem Jahr. Da die Zölle in den kommenden Monaten stärkeren Einfluss auf die Preise nehmen dürften, wird die Fed die Risiken im Hinblick darauf, ob und wann sie die Zinsen senkt, sorgfältig abwägen müssen. Ich bin weiterhin der Ansicht, dass der Spielraum für Zinssenkungen – sofern es nicht zu einem deutlichen Abschwung kommt – extrem begrenzt ist, da sich der Leitzins sehr nahe am nach meiner Einschätzung natürlichen Niveau bewegt.
- Die langfristige fiskalpolitische Herausforderung bleibt bestehen. Bleibt ein Produktivitätswunder aus, muss diese durch eine Kombination aus Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen bewältigt werden. Es wird also interessant sein zu sehen, ob diese deutlichen Zollerhöhungen einen ersten Schritt in Richtung einer stärkeren Ausrichtung auf indirekte Steuern darstellen – ein Weg, den zahlreiche andere Industrieländer bereits eingeschlagen haben.
Fußnoten
- Quelle: How much are US tariffs raising in revenue? Bipartisan Policy. 23. April 2025.
- Es kann nicht zugesichert werden, dass sich Prognosen, Schätzungen oder Hochrechnungen als richtig erweisen.
- Quelle: H.R. 1, One Big Beautiful Bill Act. Congressional Budget Office. 17. Juni 2025.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich.
Festverzinsliche Wertpapiere bergen Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie das Risiko eines möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren.
Beteiligungspapiere unterliegen Kursschwankungen und sind mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden.
Es kann nicht zugesichert werden, dass sich Prognosen, Schätzungen oder Hochrechnungen als richtig erweisen.