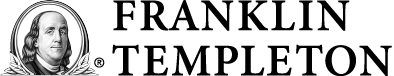AUTOREN

Sonal Desai, Ph.D.
Chief Investment Officer, Franklin Templeton Fixed Income
Nach Monaten der Ungewissheit ist die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am „Tag der Befreiung“ ein Schritt hin zu mehr Klarheit in der Zollpolitik. Die Ankündigung stellt die Weichen für mögliche bilaterale Verhandlungen; die Ungewissheit ist also nicht vorüber, aber zumindest liegt nun das Worst-Case-Szenario auf dem Tisch.
Eine bessere Bezeichnung wäre „T-Day“ – der „Tariff Day“ bzw. Tag der Zölle. Die wichtigsten Punkte: Es werden zusätzliche Zölle von durchschnittlich 34 % auf Importe aus China (und somit Gesamtzölle von 54 %) und von 20 % auf Einfuhren aus der Europäischen Union erhoben. Für Kanada und Mexiko bleiben Waren gemäß dem USMCA-Abkommen (United States-Mexico-Canada Agreement) ausgenommen, während die übrigen Waren mit Zöllen belegt werden. Für andere Länder variieren die Zölle, betragen jedoch mindestens 10 %. Außerdem wird ein Pauschalzoll von 25 % auf Autos erhoben.
Die Ungewissheit, mit der wir bisher konfrontiert waren, hat Unternehmen dazu veranlasst, ihre Investitionspläne zurückzustellen. Das wiederum hat das Wachstum im ersten Quartal des Jahres gebremst. Angesichts der zunehmenden Klarheit dürften Unternehmen allmählich in der Lage sein, ihre Pläne neu festzulegen. Allerdings besteht noch immer große Ungewissheit vor allem im Hinblick auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen, die in einen umfassenderen Handelskrieg ausufern könnten.
Ich hielt es dennoch für sinnvoll, die Auswirkungen dieser Zölle mit einigen einfachen Berechnungen zu veranschaulichen.
Die Regierung Trump geht davon aus, dass die neuen Zölle rund 600 Mrd. USD pro Jahr einbringen werden. Einige sind skeptisch, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Daher sollten wir es als Obergrenze betrachten und auch ein alternatives Szenario mit geringeren Einnahmen von 400 Mrd. USD in Betracht ziehen.
Zölle sind eine Steuer: Sie erhöhen die Staatseinnahmen, aber wie alle Steuern beeinträchtigen sie das Wachstum. Sie sind eine Steuer auf den Konsum, insbesondere auf den Konsum von Importwaren. Wie hoch ist die Steuererhöhung, um die es hier geht? Auf der Grundlage der Zahlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für 2024 (Quelle: Bureau of Economic Analysis) belief sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA auf 29 Bio. USD. Fast 70 % davon, also nahezu 20 Bio. USD, entfielen auf den Konsum.
Die erwarteten Einnahmen in Höhe von 400 Mrd. USD bis 600 Mrd. USD entsprächen daher einer Steuer von 2 % bis 3 % auf den Gesamtkonsum von Waren und Dienstleistungen. Dies käme zudem einem durchschnittlichen Zollsatz von 12 % bis 18 % auf alle Wareneinfuhren gleich (im Jahr 2024 beliefen sich die Wareneinfuhren auf etwa 3,3 Bio. USD). Die Zahlen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst. Wie ich bereits in früheren Artikeln festgestellt habe, ist der Anteil der Importe am US-BIP sehr gering. Daher treffen hohe Zölle nur einen kleinen Teil des US-Gesamtkonsums und entsprechen insgesamt recht niedrigen Umsatzsteuersätzen.
|
|
Niedrige Schätzung |
Hohe Schätzung |
|
Erwartete Zolleinnahmen in Mrd. USD |
400 |
600 |
|
Entsprechender Umsatzsteuersatz auf alle Waren und Dienstleistungen |
2 % |
3 % |
|
Entsprechender durchschnittlicher Zollsatz |
12 % |
18 % |
Nehmen wir an, die Regierung hätte eine pauschale Umsatzsteuer von 2 % bis 3 % angekündigt. Meines Erachtens wäre die Reaktion der Analysten und des Marktes vielleicht weniger panisch als einige der Schlagzeilen, die wir lesen. Es gäbe einige Bedenken wegen der negativen Auswirkungen auf das Wachstum, aber nur wenige würden eine Rezession vorhersagen. Auch glaube ich nicht, dass irgendjemand die Annahme infrage stellen würde, dass der Inflationsanstieg vorübergehend wäre. Nach unseren Schätzungen würden diese Zölle die Inflation vorübergehend in einer Größenordnung von 1,25 bis 1,50 Prozentpunkten (%P) beeinflussen.
Wer wird letztlich die Last dieser Einfuhrsteuer tragen: die US-Verbraucher oder die ausländischen Produzenten? Zölle werden immer vom Importeur bezahlt. Allerdings verfügen die USA über eine erhebliche Verhandlungsmacht. Der US-Verbraucher gilt seit jeher als Hauptmotor des Weltwirtschaftswachstums und für viele Länder sind die USA ein wichtiger Exportmarkt. Ausländische Hersteller dürften daher bereit sein, einen Teil der Zölle aufzufangen und dazu ihre Gewinnmargen zu drücken, um ihren Marktanteil zu halten. Schließlich waren viele Unternehmen bereit, ihr geistiges Eigentum von chinesischen Konkurrenten „besteuern“ zu lassen, um Zugang zum großen chinesischen Markt zu erhalten. Wenn der Wettbewerb aber funktioniert, sollte der Spielraum für die Verringerung der Gewinnmargen begrenzt sein, sodass der US-Verbraucher den größten Teil der zusätzlichen Steuerlast tragen wird.
Eine Umsatzsteuer von 2 % bis 3 % würde wenig Aufsehen erregen. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler und Experten für öffentliche Finanzen sind sich einig, dass eine Verbrauchssteuer der effizienteste Weg ist, um beträchtliche Einnahmen zu erzielen – und damit einer Einkommens- oder Kapitalsteuer vorzuziehen sind. Aus diesem Grund setzen europäische Länder mit Staatsausgabenquoten zwischen 45 % und 50 % des BIP auf die Mehrwertsteuer.
Importzölle sind jedoch ein ineffizientes Mittel zur Besteuerung des Konsums. Da sie einige Waren besteuern, andere aber nicht, verzerren sie Konsumentscheidungen. Durch die zusätzliche Belastung ausländischer Hersteller verringern sie den Wettbewerb. Inländische US-Hersteller werden weniger Anreize haben, ihre Produktivität zu steigern. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich ein geringeres Produktivitätswachstum und ein etwas höherer zugrunde liegender Inflationsdruck im Warensektor.
Wie alle Steuern müssen auch Zölle im Rahmen der allgemeinen Finanzpolitik bewertet werden. Trump deutete an, dass sich der Schwerpunkt nun auf Steuer- und Ausgabenkürzungen verlagern wird. Zusätzliche Senkungen der Einkommenssteuer für Privatpersonen und Unternehmen würden die nachteiligen Auswirkungen der Zölle auf das Wachstum abfedern. Allerdings gibt es hier einen Kompromiss: Umfangreichere Einkommensteuersenkungen würden auch einen Teil der Auswirkungen der Zölle auf die Einnahmen wettmachen. Um die Haushaltsdefizite auf einen nachhaltigeren Pfad zu lenken, bin ich nach wie vor der Ansicht, dass die USA signifikante Ausgabenkürzungen vornehmen müssen, die weit über das hinausgehen, was das Department of Government Efficiency (Abteilung für Regierungseffizienz) realistisch erreichen kann.
Im Laufe der Zeit könnten die Importzölle theoretisch einige Unternehmen dazu veranlassen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, werden jedoch auch von anderen Faktoren abhängen. Dazu gehören Vorschriften, die Stabilität und Vorhersehbarkeit des allgemeinen makroökonomischen Umfelds, die Qualität der Infrastruktur, die Energiekosten und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit den erforderlichen Qualifikationen. Die Verlagerung der Produktion wird einige Zeit dauern, in vielen Fällen mindestens drei bis fünf Jahre.
Zölle sind sicherlich nicht mein bevorzugtes politisches Instrument. Nach meinen groben Schätzungen dürften die Auswirkungen auf das US-Wachstum und die Inflation überschaubar sein. Allerdings herrscht nach wie vor große Ungewissheit über die möglichen globalen Auswirkungen. Erstens werden die Auswirkungen auf das Wachstum in den Ländern, die stärker auf Exporte als Wachstumsmotor angewiesen sind, sehr viel deutlicher sein. Zweitens könnte eine Umlenkung der Handelsströme weitreichendere Zollerhöhungen nach sich ziehen und einen größeren Handelskrieg mit eskalierenden Gegenzöllen auslösen. Die negativen Auswirkungen auf das globale und das US-Wachstum wären dann noch gravierender.
Während der nächsten Runde der handelspolitischen Gespräche ist es jedoch für die Regierung – und für die Anleger – an der Zeit, ihre Aufmerksamkeit und ihren Fokus auf Steuern und Deregulierung zu richten. Fortschritte in diesen Bereichen würden entscheidend dazu beitragen, den Schaden der Zölle auszugleichen. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass das BIP-Wachstum der USA in diesem Jahr niedriger ausfallen wird. Denn der Schaden ist bereits im ersten Quartal entstanden und die Schwäche wird wahrscheinlich bis ins zweite Quartal anhalten. Darüber hinaus sehe ich Aufwärtsrisiken für die Inflation, wenn auch nur als vorübergehenden Schock von 1,25 bis 1,50 %P. Insgesamt bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass die Federal Reserve (Fed) bis zum Jahresende höchstens eine Zinssenkung vornehmen wird. Unter der Annahme, dass konkrete Maßnahmen zur Deregulierung und weitere Steuerkürzungen kommen, dürfte die Bilanz der Inflations- und Wachstumsrisiken die Fed meiner Meinung nach dazu veranlassen, von stärkeren Zinssenkungen abzusehen. Auf dieser Grundlage und mit dem oben erwähnten Vorbehalt der Ungewissheit über das Weltwirtschaftswachstum dürften die Risiken für US-Staatsanleihenrenditen nach oben tendieren.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich.
Festverzinsliche Wertpapiere bergen Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie das Risiko eines möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren.