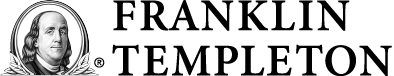AUTOREN

Sonal Desai, Ph.D.
Chief Investment Officer,
Franklin Fixed Income
Während des Jahres 2023 hat das US-Produktivitätswachstum rasant an Fahrt aufgenommen. An den Finanzmärkten werden verschiedene Messgrößen wie Inflation, Lohnwachstum, Schwankungen bei Beschäftigung und Arbeitslosigkeit sowie das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen genau beobachtet. Meines Erachtens könnte sich jedoch die Produktivität als die interessanteste und wichtigste wirtschaftliche Entwicklung herausstellen, weshalb man ihr mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.
Die Produktivität gibt uns Aufschluss darüber, wie viel eine Volkswirtschaft mit einer bestimmten Menge an Ressourcen erzeugen kann. Insbesondere die Arbeitsproduktivität drückt aus, wie viel die Arbeitskräfte einer Volkswirtschaft mit dem vorhandenen Kapitalbestand und der verfügbaren Technologie produzieren können. Ein kräftigeres Produktivitätswachstum führt zur schnelleren Anhebung des Pro-Kopf-Einkommens und des Lebensstandards. Zudem hat es wichtige Folgen für die Finanzmärkte: Jeder Dollar, der in die Realwirtschaft investiert wird, bringt eine höhere Rendite. Unter ansonsten gleichen Bedingungen sollte sich dies in einer stärkeren Wertentwicklung an den Aktienmärkten niederschlagen.
Ein schnelleres Produktivitätswachstum ist auch mit größeren realen Investitionsmöglichkeiten und einer entsprechend höheren Kapitalnachfrage verbunden – und führt daher in der Regel zu einem höheren Gleichgewichtszinssatz („neutraler“ Zinssatz), dem berühmten „r*“. Dies wird in der folgenden Grafik deutlich, die eine enge Korrelation zwischen dem Produktivitätswachstum und dem geschätzten neutralen Zinssatz aufzeigt.
Abbildung 1: US-Produktivitätswachstum und der neutrale Zinssatz
1960–2024

Quellen: Franklin Fixed Income Research, BLS, New York Fed, Macrobond. Stand: 7. Februar 2024. Das Laubach-Williams-Modell des natürlichen Zinssatzes ermöglicht Schätzungen des natürlichen Zinssatzes bzw. realen Gleichgewichtszinssatzes („R-Star“) und verwandter Variablen.
In den letzten zehn Jahren argumentierten die Anhänger der Hypothese der säkularen Stagnation, dass ein strukturell niedrigeres Produktivitätswachstum auch künftig zu einem schwachen Wirtschaftswachstum und dauerhaft niedrigen Zinssätzen beitragen werde. Diese Ansicht spiegelt sich nach wie vor in den Prognosen der US-Notenbank (Fed) wider, die den langfristigen Leitzins bei 2,5 % ansiedeln. Dies wiederum würde einem realen neutralen Zinssatz von nur einem halben Prozent entsprechen (langfristig wird davon ausgegangen, dass die Inflation das gesetzte Ziel von 2 % erreicht).
Wie steht es denn nun um die Produktivität? Beginnen wir mit den Fakten: Das Wachstum der Arbeitsproduktivität (Leistung je Arbeitsstunde) erhöhte sich von -0,6 % im ersten Quartal 2023 auf 1,2 % im zweiten Quartal, auf 2,3 % im dritten Quartal und auf 2,7 % im vierten Quartal.1
Der spätere Zeitraum des letzten Jahres stimmt besonders zuversichtlich: Das jährliche Produktivitätswachstum lag in den letzten neun Monaten bei durchschnittlich 2 % und in den letzten sechs Monaten bei 2,5 %.2 Zum besseren Verständnis der Bedeutung dieser Zahlen sollten wir sie im historischen Vergleich betrachten.
In den zwei Jahrzehnten zwischen 1974 und 1995 lag das Produktivitätswachstum in den USA bei durchschnittlich 1,5 %. Zwischen 1996 und 2005 verdoppelte sich dann das Produktivitätswachstum auf 3 %.3 Zahlreiche wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass die erste Welle der digitalen Innovation, die so genannte Revolution der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), den Hauptanteil an dieser Beschleunigung hatte. In dieser Zeit eroberten Computer die Wirtschaft und die Unternehmen fanden nach und nach heraus, wie sie deren Leistungsfähigkeit zur Steigerung der Effizienz nutzen konnten. Danach ließen die Impulse der IKT-Welle nach und das Produktivitätswachstum sank zwischen 2006 und 2022 wieder auf durchschnittlich 1,5 % pro Jahr.
Abbildung 2: US-Produktivitätswachstum
1974–2023

Quellen: Franklin Fixed Income Research, BLS. Stand: 7. Februar 2024.
War die Beschleunigung des Produktivitätswachstums im späteren Verlauf des Jahres 2023 womöglich ein Wendepunkt, eine Rückkehr zur 3 %igen Wachstumsrate des letzten goldenen Jahrzehnts? Es darf nicht vergessen werden, dass die vierteljährlichen Produktivitätszahlen sehr volatil sind. Dennoch gibt es aus meiner Sicht einige Gründe, die dafür sprechen, dass wir die jüngsten Zahlen nicht vorschnell als „statistisches Rauschen“ abtun dürfen und die Daten stattdessen genau verfolgen sollten:
- Die Daten sind zwar volatil, aber seit 2006 gab es nur eine weitere Zeitspanne, in der sich das Produktivitätswachstum mindestens zwei Quartale lang auf über 2 % beschleunigte: zwischen dem dritten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020. (Abgesehen von den Erholungsphasen nach der globalen Finanzkrise und nach der Corona-Pandemie, wo Produktivitätsveränderungen durch massive Schwankungen der Beschäftigung bestimmt wurden.)
- Die jüngste Produktivitätsbeschleunigung vollzog sich vor dem Hintergrund eines extrem starken Arbeitsmarktes. Diese Entwicklung ist nicht auf Entlassungen zurückzuführen, sondern eher darauf, dass die Unternehmen in einer Situation von (mehr als) Vollbeschäftigung zu größerer Effizienz finden, was sich in einem langsameren Tempo bei den Neueinstellungen widerspiegelt.
- Die letzten zehn Jahre waren von beeindruckenden Fortschritten bei neuen Technologien geprägt. Selbst unter Berücksichtigung der Hype-Phasen mit ihren unvermeidlichen Übertreibungen besteht kein Zweifel daran, dass in den letzten zehn Jahren eine beeindruckende Dynamik der technologischen Innovation stattgefunden hat, insbesondere in der Kategorie Industrie 4.0. Und so wäre es überraschend, wenn diese neue Innovationswelle nicht irgendwann eine Beschleunigung des Produktivitätswachstums auslösen würde. (Ich spreche hier noch nicht einmal von den potenziellen Auswirkungen der generativen KI – dies wäre viel zu früh, da diese sich erst zeigen müssen.)
In den vergangenen zehn Jahren haben sich Wirtschaftswissenschaftler mit der Frage beschäftigt, warum all diese Innovationen nicht zu einem schnelleren Produktivitätswachstum geführt haben. Nach Ansicht mancher wird der Wert der Produktionsleistung unterschätzt und damit auch die Produktivität, weil digitale Innovationen viele kostenlose Nebeneffekte haben und hedonische Anpassungen dies nicht vollständig erfassen. Das klassische Beispiel ist das Smartphone, das zwar teuer ist, aber als Telefon, Kamera, Taschenrechner, Navigationsgerät usw. dient. Laut mehreren Studien macht dies jedoch nur einen geringen Teil der „fehlenden“ Produktivität aus. Andere behaupten, dass digitale Innovationen kaum mehr als Spiele und Werbung sind und keinen nennenswerten Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben. Doch diese Argumentation, die vor allem von dem Wirtschaftswissenschaftler Robert Gordon von der Northwestern University vertreten wird, scheint die Macht der vielen neuen Technologien, die entwickelt und eingesetzt werden, zu unterschätzen.
Als dritte Erklärung kann man anführen, dass das Ganze einfach Zeit braucht. Viele Unternehmen müssen erst noch herausfinden, wie sie neue Technologien einsetzen, ihren Betrieb umstrukturieren und ihre Mitarbeiter in neuen Fertigkeiten schulen können. Das gab es schon einmal. Bekanntermaßen scherzte Robert Solow im Jahr 1987 wie folgt: „Das Computerzeitalter ist überall erkennbar, außer in den Produktivitätsstatistiken.“ Wenige Jahre später hatte sich das Produktivitätswachstum verdoppelt. Zwar ist nicht sicher, dass wir kurz vor einem weiteren Produktivitätsboom stehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Entwicklung im Auge zu behalten.
Angesichts der Frage, wo sich die Zinssätze nach dem Ende der Inflationsbekämpfung einpendeln werden, erscheint diese Debatte besonders relevant. In seiner jüngsten Pressekonferenz erklärte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, er rechne mit einer Abschwächung des Produktivitätswachstums hin zu den früheren Trends. Andere Fed-Vertreter äußerten sich jedoch optimistischer. Sollte das Produktivitätswachstum tatsächlich nachhaltiger steigen, wird der neutrale Zinssatz deutlich höher sein, als die Fed bisher in ihren Prognosen angegeben hat und als es die Märkte erwarten. Wie ich bereits seit geraumer Zeit anmerke, wäre ein Gleichgewichtszinssatz von etwa 4 % realistischer als die 2,5 %, die in den Prognosen der Fed genannt werden. Deshalb halte ich die Produktivität definitiv für eine Variable, die genau verfolgt werden muss.
Fußnoten
- Quelle: Bureau of Labor Statistics. Stand: 7. Februar 2024.
- Ebd.
- Ebd.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich.
Beteiligungspapiere unterliegen Kursschwankungen und sind mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden.
Festverzinsliche Wertpapiere sind mit Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie mit dem Risiko eines möglichen Verlusts des Anlagebetrags verbunden. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren. Niedrig bewertete, hochverzinsliche Anleihen sind höheren Preisschwankungen, Illiquiditätsrisiken und der Möglichkeit eines Ausfalls ausgesetzt.