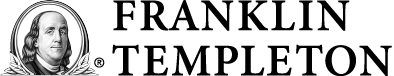AUTOREN

Nicholas Hardingham, CFA
Portfolio Manager, Franklin Templeton Fixed Income

Stephanie Ouwendijk, CFA
Portfolio Manager, Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Robert Nelson, CFA
Portfolio Manager, Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Joanna Woods, CFA
Portfolio Manager, Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Sterling Horne, Ph.D
Research Analyst,
Franklin Templeton Fixed Income

Carlos Ortiz
Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Jamie Altmann
Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Samantha Higgins
Analyst,
Franklin Templeton Fixed Income
Vorschau
Anleger sorgen sich zunehmend über eine Deglobalisierung, da verschiedene geopolitische, wirtschaftliche und technologische Veränderungen die seit Jahrzehnten wachsende globale Integration durchbrechen. Die Vorstellung, dass die Vernetzung des Welthandels abnimmt, könnte schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben, wobei die Schwellenländer potenziell anfällig werden könnten.
Zu den wichtigsten Faktoren, die zur Deglobalisierung beitragen, zählen wirtschaftlicher Nationalismus und Populismus. Populisten machen oft die Globalisierung für wirtschaftliche Schwierigkeiten verantwortlich, was den Schwerpunkt auf den Schutz von heimischen Industrien, Arbeitsplätzen und Kapital verlagert, anstatt die internationale Zusammenarbeit zu fördern, wie der politische Kurswechsel in den USA in letzter Zeit zeigt. Wirtschaftlicher Nationalismus geht mit Maßnahmen gegen Einwanderung und kulturellem Protektionismus einher, wie beispielsweise beim Brexit, was in manchen Fällen dazu führen kann, dass sich ein Land aus den globalen Märkten zurückzieht. Darüber hinaus beschleunigen eskalierende geopolitische Spannungen und nationale Sicherheitsbedenken offenbar diese Abkehr von der globalen Vernetzung. Konflikte wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und der Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Lieferketten auf unterschiedliche Weise beeinträchtigt. Unterdessen hat die Nutzung globaler Institutionen wie der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) als Waffe eine neue Schwachstelle für staatliche Rentenmärkte erzeugt, die traditionell von den Verflechtungen der globalen Märkte abhängig waren. Das wiederum war ein Katalysator für eine Neubewertung der traditionellen globalen Marktarchitektur. Außerdem hat die Corona-Pandemie eine grundlegende Neubewertung der globalen wechselseitigen Abhängigkeit ausgelöst, vor allem in wichtigen Branchen wie der Halbleiterindustrie.
In diesem Beitrag untersuchen wir, ob tatsächlich eine Deglobalisierung stattfindet, und bewerten die potenziellen Risiken, die eine Deglobalisierung für Schwellenländer mit sich bringt.
Unser Fazit
Während unter Anlegern die Sorge über eine Deglobalisierung zunimmt, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die Welt fundamental weniger vernetzt ist. Obwohl die Globalisierung in den letzten zwei Jahrzehnten auf einem Plateau verharrt hat, könnten die jüngsten politischen Veränderungen und wachsenden geopolitischen Spannungen dennoch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Trotz dieser Risiken sind wir der Ansicht, dass die Schwellenländer gut aufgestellt und auch weiterhin resilient sind – und möglicherweise sogar gestärkt aus der Situation hervorgehen werden.
Die Schwellenländer genießen nach wie vor einen bedeutenden Kostenvorteil gegenüber den Industrieländern, wo steigende Arbeitskosten zunehmend untragbar werden. Die neuesten Änderungen der US-Zölle könnten eine Neuordnung der Lieferketten zugunsten kosteneffizienterer Schwellenländer auslösen. Darüber hinaus dürften die zunehmende Spezialisierung und die Fähigkeit der Schwellenländer, Skaleneffekte zu erzielen, die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Handels stützen, da die Verlagerung der Produktion aus den Schwellenländern kostspielig und komplex bleibt.
Angesichts der langsameren globalen Integration haben viele Schwellenländer ihre regionalen Wirtschaftsbeziehungen vertieft – getragen von einer wachsenden Mittelschicht und günstigen demografischen Entwicklungen. Dadurch hat sich die Integration innerhalb der Region weiter gefestigt. Unserer Einschätzung nach dürfte sich dieser Trend fortsetzen, zumal die regionalen Handelsströme von den politischen Maßnahmen der Industrieländer weitgehend unberührt bleiben. Dank der Entwicklung umfassenderer und stabilerer lokaler Anleihemärkte sind die Schwellenländer inzwischen auch weniger von globalen Kapitalflüssen abhängig. Durch diese Verbesserungen der eigenen Finanzsysteme wurde ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks gestärkt.
Damit die Schwellenländer ihr Potenzial jedoch voll ausschöpfen können, sind unserer Meinung nach unterstützende Maßnahmen zur Förderung des Handels unerlässlich. Die Infrastruktur bleibt in vielen Regionen ein wesentliches Hindernis, und es bedarf weiterer Investitionen in Logistik, Transport und Anbindung, um zusätzliches Wachstum zu ermöglichen. Daher könnten einige Länder besser abschneiden als andere. Insgesamt halten wir die Befürchtungen, dass eine Deglobalisierung negative Auswirkungen auf die Schwellenländer haben könnte, für übertrieben.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich.
Festverzinsliche Wertpapiere bergen Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie das Risiko eines möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren.
Internationale Anlagen sind mit besonderen Risiken verbunden. Hierzu gehören Währungsschwankungen sowie gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten, die zu erhöhter Volatilität führen können. Diese Risiken sind in Schwellenländern noch größer. Anlagen in Unternehmen eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region können einer größeren Volatilität unterliegen als Anlagen, die geografisch breiter gestreut sind.
Der Einfluss der Regierung auf die Wirtschaft ist noch immer hoch, und daher spielen bei Investitionen in China Regulierungsrisiken im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine größere Rolle.
Die Vermögensallokation auf verschiedene Strategien, Anlageklassen und Investments kann sich als nicht vorteilhaft erweisen und zu anderen als den gewünschten Ergebnissen führen.
Staatliche Schuldtitel sind mit diversen zusätzlichen Risiken verbunden, die zu den mit Schuldtiteln und ausländischen Wertpapieren im Allgemeinen verbundenen Risiken hinzukommen. Zu diesen zusätzlichen Risiken gehört unter anderem, dass ein staatlicher Emittent nicht willens oder nicht in der Lage sein könnte, Zins- und Tilgungszahlungen für seine Staatsschulden zu leisten.
WF: 6745209