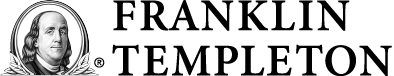AUTOREN

Nicholas Hardingham, CFA
Portfolio Manager, Franklin Templeton Fixed Income

Stephanie Ouwendijk, CFA
Portfolio Manager, Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Robert Nelson, CFA
Portfolio Manager, Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Joanna Woods, CFA
Portfolio Manager, Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Carlos Ortiz
Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income

Jamie Altmann
Research Analyst, Franklin Templeton Fixed Income
Vorschau
Inspiriert durch den Vorschlag des argentinischen Präsidenten Javier Millei zur Dollarisierung Argentiniens, befasst sich dieser Beitrag mit dem Phänomen der Dollarisierung. Dabei führen Länder eine Fremdwährung, zumeist den US-Dollar, ein, um ihre wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und ihre Ziele zu erreichen.
Verschiedene Faktoren fördern den Trend zur Dollarisierung. Die Geldwertstabilität stellt dabei den wichtigsten Katalysator dar. Aus diesem Grund betrachten Länder, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie Währungsabwertungen und Hyperinflation konfrontiert sind (beispielsweise Ecuador und Simbabwe), die Dollarisierung als einen schnellen Weg zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts. Dagegen tendieren Länder mit einer offenen Wirtschaft und einem robusten Privatsektor (wie Panama) zu einer Dollarisierung, um so den Handel und die wirtschaftliche Stabilität zu verbessern. Diese Strategie erweist sich insbesondere dann als vorteilhaft, wenn die angenommene Währung sich an den wichtigsten Kapital- und Handelspartnern eines Landes orientiert. Beispiele hierfür sind die Beziehungen zwischen den USA und Panama, dem Euroraum und Ländern wie Montenegro/Kosovo sowie zwischen Südafrika und Lesotho/Eswatini. Darüber hinaus verdeutlichen Fälle wie El Salvador das Bestreben, die bereits erreichte Währungsstabilität zu stärken, um so weitere ausländische Investoren anzuziehen und Vertrauen in die nationale Wirtschaft zu fördern.
Wir unterscheiden zwischen einer vollständigen und einer weichen Dollarisierung und gehen auf die Gründe für diese unterschiedlichen Ausprägungen der Dollarisierung ein.
- Formen der Dollarisierung.
- Dollarisierung: eine Kosten-Nutzen-Analyse.
- Wie läuft die Dollarisierung ab?
- Argentinien: Dollarisierung im Blick
- Simbabwes System der verschiedenen Währungen – ein zweischneidiges Schwert
- Funktioniert es auch praktisch?
Unsere Analyse enthüllt unterschiedliche Erfolgsraten: Während die Dollarisierung am einen Ende des Spektrums zu einer höheren wirtschaftlichen Stabilität und einem größeren Vertrauen in das Finanzsystem geführt hat, hatten andere Länder mit dem vollständigen Verlust ihrer geldpolitischen Autonomie zu kämpfen und es kam zu nationalistischen Verwerfungen.
Die Auswertung verschiedener Fallstudien macht deutlich, dass sowohl die Motive für die Dollarisierung als auch der Prozess und die Ergebnisse dieser Maßnahme sehr unterschiedlich sind und es dafür keinen allgemeingültigen Ansatz gibt.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich.
Festverzinsliche Wertpapiere sind mit Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren.
Internationale Anlagen sind mit besonderen Risiken verbunden. Hierzu gehören Währungsschwankungen sowie gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten, die zu erhöhter Volatilität führen können. Diese Risiken sind in Schwellenländern noch größer. Anlagen in Unternehmen eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region können einer größeren Volatilität unterliegen als Anlagen, die geografisch breiter gestreut sind.
Anlagen in ausländische Wertpapiere sind mit besonderen Risiken verbunden, unter anderem Risiken in Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, Handelspraktiken, Verfügbarkeit von Informationen, Marktbeschränkungen und Wechselkursschwankungen sowie Wechselkurspolitik; bei Anlagen in Schwellenländern sind diese Risiken noch stärker ausgeprägt.
Staatliche Schuldtitel sind mit diversen zusätzlichen Risiken verbunden, die zu den mit Schuldtiteln und ausländischen Wertpapieren im Allgemeinen verbundenen hinzukommen, einschließlich unter anderem des Risikos, dass ein staatlicher Emittent nicht Willens oder in der Lage ist, Zins- und Tilgungszahlungen auf seine Staatsschulden zu leisten. Sofern sich eine Strategie auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Sektoren oder Arten von Anlagen konzentriert, kann sie anfälliger für ungünstige Entwicklungen in solchen Schwerpunktbereichen sein als eine Strategie, die auf Investitionen in ein breiteres Spektrum von Ländern, Regionen, Branchen, Sektoren oder Anlageformen setzt.
Alle Unternehmen und/oder Fallstudien im vorliegenden Dokument dienen lediglich der Veranschaulichung. Eine entsprechende Anlage wird derzeit nicht unbedingt in einem von Franklin Templeton empfohlenen Portfolio gehalten. Die bereitgestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch eine individuelle Anlageberatung in Bezug auf bestimmte Wertpapiere, Strategien oder Anlageprodukte dar und sind kein Hinweis auf Handelsabsichten eines durch Franklin Templeton verwalteten Portfolios.