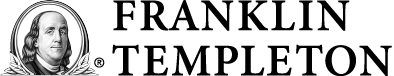Der Wachstumsmotor Deutschland stottert. Für diejenigen, die ein langes Gedächtnis haben, erinnert die aktuelle Wachstumsschwäche in Deutschland an die Zeit, als das Land 1999 den Beinamen „kranker Mann Europas“ erhielt. Wiederholt sich die Geschichte oder ist diese Sorge übertrieben?
Prognosen für den kranken Mann Europas
Deutschland wird immer häufiger als „kranker Mann“ bezeichnet, da das Land weiterhin schlechter abschneidet als andere Wirtschaftsräume der Eurozone. Zuvor hatte Deutschland mehr als 20 Jahre lang ein solides Wachstum verzeichnet, das durch eine Kombination aus aggressiven Reformen der früheren Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder und einer zunehmend globalisierten Handelswelt, insbesondere durch den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO), begünstigt wurde. Deutschland hat von dieser stärker globalisierten Welt profitiert. Nach Überwindung der pandemiebedingten Wachstumsschwäche ist der deutsche Konjunkturmotor zuletzt jedoch ins Stottern geraten. Was hat sich verändert? Und sind die Probleme Deutschlands womöglich endemisch?
Im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA ist die Leistung Deutschlands eher dürftig (siehe Abbildung 1). Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der deutschen Wirtschaft war zuletzt auf Quartalsbasis rückläufig. Die Konsumausgaben sind weiter zurückgegangen, obwohl durch steigende Einkommen und sinkende Inflation ein Sparpuffer entstanden ist. Die Industrieproduktion nimmt weiterhin ab, und die Investitionsausgaben leiden unter den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Deutschland steht am Rande einer Rezession. Auch in anderen Ländern der Eurozone hat sich die Konjunktur abgeschwächt – aber nirgendwo so stark wie in Deutschland. Es stellt sich die Frage, ob die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands nur eine Folge des Konjunkturzyklus sind, die durch eine Lockerung der Geldpolitik gemildert werden kann, oder ob hier beunruhigende strukturelle Kräfte am Werk sind.
Abbildung 1: BIP-Wachstumsgefälle zwischen den USA und Deutschland
In Prozent, US abzüglich Deutschland. Stand: Q2 2023

Quellen: Brandywine Global, Macrobond.
Die Problematik im Detail
In den letzten rund 20 Jahren wurde Deutschland als nahezu unaufhaltsamer Industriemotor bewundert. Doch heute sind die Deutschen zunehmend unzufrieden mit der Wirtschaft und der Leistung der Regierung. Das Vertrauen in die Wirtschaft hat sich dramatisch verschlechtert, was zum Teil den plötzlichen Anstieg der Popularität der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) mit ihrem europaskeptischen und einwanderungsfeindlichen Programm erklären könnte. Warum also ist das Wachstum ins Stocken geraten? Worin unterscheiden sich die Probleme der Wirtschaft von denen im übrigen Europa? Zum einen haben die restriktive Haushaltspolitik der Regierung und die „Schuldenbremse“ die öffentlichen Ausgaben für Infrastruktur eingeschränkt und damit das Wachstumspotenzial verringert.
Das deutsche Modell
Mit den Reformen der Regierung Schröder begann eine Zeit des deutschen Exzeptionalismus. Die deutsche Fertigungs- und Ingenieurskunst wurde weltweit bewundert. Die Wirtschaft wurde zu einer Exportmaschine, die von billigem russischem Gas profitierte. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine stiegen die Erdgaspreise jedoch sprunghaft an, so dass Energieengpässe und Rationierungen drohten. Zwar konnte das Schlimmste abgewendet werden, da Deutschland Speicherkapazitäten aus nicht-russischen Quellen aufbaute und seine Anstrengungen zur Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien beschleunigte, der Krieg in der Ukraine lüftete jedoch den Vorhang vor den Risiken für das deutsche Wirtschaftswachstum.
Energieintensive Branchen wie Chemie, Papier und Papierprodukte sowie Basismetalle wurden von der Energiekrise hart getroffen. Insbesondere im europäischen Vergleich ist Deutschland aufgrund dieser Sektoren ein großer Verbraucher von Erdgas und Strom. In Deutschland wird immer noch mehr Energie verbraucht als in Frankreich, Spanien und Italien. Auch die CO2-Emissionen pro Kopf weisen auf einen nach wie vor großen CO2-Fußabdruck hin: Hier liegt das Land ebenfalls über dem Niveau von Frankreich, Spanien und Italien, während die Investitionen in erneuerbare Energien hinterherhinken.1 Der Energieverbrauch in Deutschland könnte die Produktionskosten in die Höhe treiben und damit Unternehmen aus dem Markt drängen oder sie zwingen, ihre Produktion in ein kostengünstigeres Land zu verlagern. Die Sicherheit der Energieversorgung bleibt ein hohes Risiko, auch wenn Deutschland auf 100 % erneuerbare Energien umsteigen will.
Hohe Abhängigkeit vom globalen Wachstum
Das deutsche Wirtschaftsmodell ist auf den Handel ausgerichtet. Der Kurs der deutschen Wirtschaft ist ein Spiegelbild der Entwicklung der Weltwirtschaft. Jeder Schock für das globale Wachstum trifft die deutsche Wirtschaft über den Handel. Dieses Risiko lässt sich vereinfachend durch die Berechnung eines Maßes für die wirtschaftliche Offenheit erfassen. Diese Kennzahl ergibt sich aus der Summe der Importe und Exporte dividiert durch das BIP. Abbildung 2 zeigt die Berechnung für Deutschland im Vergleich zu den USA.
Abbildung 2: Außenhandel – Deutschland vs. USA
Prozent des BIP, EUR (links), USD (rechts). Stand: 1. Oktober 2023

Quellen: Brandywine Global, Macrobond, DESTATIS, BEA.
Je höher der Prozentsatz für ein Land ist, desto stärker ist es vom globalen Wachstum, vom Welthandel und von der Weltwirtschaft abhängig. In Deutschland liegt der prozentuale Offenheitsgrad bei beachtlichen 70 %, in den USA hingegen bei relativ niedrigen 25 %. Das globale Wachstum wird sich 2024 voraussichtlich abschwächen, was neben der zögerlichen Erholung in China auch auf die globale Wachstumsverlangsamung infolge der weltweit restriktiveren Geldpolitik zurückzuführen ist. Die USA, deren wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit im Laufe des Jahres 2023 gut dokumentiert ist, werden weniger vom globalen Wachstum als von der Binnennachfrage getragen. Aber selbst in den USA dürfte diese Widerstandsfähigkeit nachlassen.
Die wichtigsten Exportmärkte Deutschlands sind in Abbildung 3 dargestellt. Die meisten der Märkte, in die Deutschland exportiert, verzeichneten ein schwächeres Wirtschaftswachstum und damit eine geringere Nachfrage nach deutschen Exporten. Ein wichtiger Handelspartner hat sich außergewöhnlich schwach entwickelt. Dieser Partner – China – hat sich schwer getan, seine restriktive COVID-Politik hinter sich zu lassen. Gleichzeitig wird die Erholung des Landes weiterhin durch das schwache Verbrauchervertrauen und die Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt behindert. Hinzu kommt, dass China nicht mehr so sehr an den in Deutschland produzierten Autos und Industriegütern interessiert ist. Chinesische Verbraucher kaufen zunehmend Fahrzeuge, die im eigenen Land produziert wurden. Und schließlich ist es wahrscheinlicher, dass chinesische Verbraucher in China hergestellte Elektrofahrzeuge (EVs) kaufen, da die chinesischen EV-Hersteller viel weiter fortgeschritten sind als ihre deutschen Pendants. Aus geopolitischer Sicht wird China zunehmend als weniger zuverlässiger Handelspartner angesehen. Viele Länder, darunter auch Deutschland, überdenken aktuell ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China. Allerdings wird Deutschland seine Versorgungskette anpassen müssen. Dazu gehört auch die Frage, von wem es die Mineralien und Verarbeitungskapazitäten bezieht, die es für seine geplante Energiewende und die Abkehr von fossilen Brennstoffen benötigt.
Abbildung 3: Die 20 wichtigsten Exportziele Deutschlands
In Prozent, Anteil an den Gesamtexporten. Stand: November 2023

Quellen: Brandywine Global, Macrobond, DESTATIS.
Die Erwerbsbevölkerung schrumpft
Die demografische Entwicklung belastet die Wirtschaft sowohl konjunkturell als auch strukturell. Auf den ersten Blick ist der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung. Anders als in der Zeit nach der Wiedervereinigung ist eine hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland derzeit kein Problem. Die unter der Regierung Schröder eingeleiteten Reformen zur Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit haben dazu beigetragen, die Arbeitslosenquote zu senken. Hinter dieser „Stärke“ verbirgt sich jedoch eine besorgniserregende demografische Entwicklung.
Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, klagen Unternehmen heute über einen Mangel an Arbeitskräften. Dieses Diagramm versucht, die Differenz zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage zu messen. Eine negative Differenz bedeutet, dass das Arbeitskräfteangebot die Arbeitskräftenachfrage übersteigt. Dies ist das Umfeld, in dem die von der Regierung Schröder eingeleiteten Reformen notwendig geworden waren. Gegenwärtig besteht ein Nachfrageüberhang, d. h. ein Mangel an Arbeitskräften – und zwar ein erheblicher. Durch diese Verknappung wird der Faktor Arbeit teurer, wie aus Abbildung 5 hervorgeht. Dies wiederum macht die deutsche Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig.
Abbildung 4: Arbeitskräftenachfrage vs. -angebot in Deutschland
In Millionen, Arbeitskräfteangebot: Offene Stellen – Arbeitslosigkeit. Stand: Oktober 2023

Quellen: Brandywine Global, Macrobond, BUBA, German Federal Employment Agency (Bundesagentur fuer Arbeit), DESTATIS, Indeed Hiring Lab, IAB.
Abbildung 5: Lohnstückkostenindex: Deutschland vs. Frankreich
Index, Produktivität, Kosten und geleistete Arbeitsstunden, ab 1999 umbasiert. Stand: Q3 2023

Quellen: Brandywine Global, Macrobond, DESTATIS, ECB.
Unternehmensbefragungen zeigen, dass die Wirtschaft mit einem Arbeitskräftemangel konfrontiert ist. Eine dieser Erhebungen, das KfW-ifo-Fachkräftebarometer, zeigt, dass zu Beginn des zweiten Quartals 2023 mehr als 40 % der befragten Unternehmen mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen hatten. Dies stellt zwar eine Verbesserung dar, der Anteil der Unternehmen, die Engpässe melden, ist jedoch nach wie vor historisch hoch und erstreckt sich auf alle Sektoren. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Abschwächung in Deutschland erscheint ein knappes Arbeitskräfteangebot kontraintuitiv, bis man etwas weiter in die Tiefe geht.
Erstens gibt es in Deutschland ein so genanntes Kurzarbeitsprogramm. Dieses Programm ermöglicht es den Arbeitgebern, Entlassungen zu vermeiden, indem sie die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer reduzieren. Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Arbeitnehmer einen Teil des Nettolohns, der ihnen durch die Arbeitszeitverkürzung entgeht. Die Arbeitgeber zahlen die Löhne und Gehälter im Voraus, während das Kurzarbeitergeld eine Erstattungsleistung ist. Der Staat zahlt die Leistung rückwirkend an den Arbeitgeber. Ein solches Programm glättet zwar den Konjunkturzyklus, scheint aber auch die Dynamik des Arbeitsmarktes zu dämpfen. Diese Regelung würde eine drohende Rezession abmildern, könnte aber auch die Anreize zur Entlassung von Arbeitnehmern verringern. Es ist sogar möglich, dass auch Arbeitnehmer davon abgebracht werden, eine Beschäftigung in anderen Branchen zu suchen.
Zweitens wird die Lage auf dem Arbeitsmarkt durch die Alterung der Erwerbsbevölkerung und die Bemühungen des Landes, den Arbeitskräftemangel auszugleichen, noch komplizierter. Die geburtenstarken Jahrgänge scheiden in Deutschland gerade aus dem Erwerbsleben aus. Gleichzeitig ist die Geburtenrate zu niedrig, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Dies hat zur Folge, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpft – damit auch die potenzielle Wirtschaftsleistung. Abbildung 6 zeigt, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Deutschland ähnlich stark abnimmt wie in Japan. Die Geburtenrate in Deutschland liegt bei 1,53 Geburten pro Frau, verglichen mit 1,34 in Japan und 1,83 in Frankreich.2 Für eine stabile Bevölkerungszahl ist eine Geburtenrate von 2,1 erforderlich.3 In Deutschland wird die Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter weiter wachsen, während die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zurückgeht, was zu potenziellen Haushaltsproblemen im Renten- und Gesundheitsbereich führen wird. Die Abteilung für Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen prognostiziert, dass die Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter bis 2050 um 41 % zunehmen und mehr als 30 % der Gesamtbevölkerung ausmachen wird.
Abbildung 6: Vereinte Nationen, Prognosen zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
Index, 2014=100; Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren. Stand: 31. Dezember 2023

Quelle: Macrobond.Es gibt keinerlei Gewähr, dass Prognosen, Schätzungen oder Vorausberechnungen sich als richtig erweisen.
Drittens kann Deutschland politische Maßnahmen ergreifen, die ältere Arbeitnehmer beispielsweise ermutigen, länger im Erwerbsleben zu bleiben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Erwerbsquote der 55- bis 66-Jährigen gestiegen. Die Anhebung des Renteneintrittsalters ist eine dieser Maßnahmen, die es Deutschland ermöglichen würde, ältere Arbeitnehmer länger im Erwerbsleben zu halten. Die höhere Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer scheint jedoch nicht auszureichen, um den erwarteten Fachkräftemangel auszugleichen. Woher bekommt Deutschland die Fachkräfte, um die Lücke zu schließen, die durch den demografischen Wandel entsteht? Die Antwort heißt Zuwanderung. Die Bundesagentur für Arbeit schätzt, dass Deutschland jährlich 400.000 Zuwanderer benötigt, um den Fachkräftemangel zu beheben.
Die Regierung ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Zuwanderung zu fördern, aber die Zuwanderung ist zu einem politisch brisanten Thema geworden und hat die einwanderungsfeindliche Stimmung verstärkt. Die Unterstützung für rechtsextreme, einwanderungsfeindliche politische Gruppierungen nimmt zu. Nichtsdestotrotz lautet die Antwort: Zuwanderung. Für die Zuwanderung müssen aber auch politische Lösungen gefunden werden. Dazu gehören die doppelte Staatsbürgerschaft, die Möglichkeit für Personen mit fünfjähriger Duldung, ein einjähriges „Chancen-Aufenthaltsrecht“ zu beantragen, Berufs- und Sprachkurse für alle Neuzuwanderer und Programme für Fachkräfte, die ihre Familien nach Deutschland holen wollen. Gleichzeitig werden Abschiebungen rigoros durchgesetzt.
Abbildung 7: Wanderungssaldo Deutschland und Eurozone
In Millionen. Stand: 31. Dezember 2022

Quelle: Macrobond.
Fazit
- In diesem Artikel werden drei mögliche Ursachen für die jüngste konjunkturelle Abschwächung in Deutschland identifiziert: Ein fehlerhaftes Wirtschaftsmodell, eine hohe Exportabhängigkeit und eine schrumpfende (alternde) Erwerbsbevölkerung. Dieser kurze Kommentar kratzt nur an der Oberfläche der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands, zu denen unter anderem die sich entwickelnde Finanzkrise und die schleppende Energiewende gehören.
- Die Zeiten, in denen billige russische Energie den Wachstumsmotor Deutschlands angetrieben hat, sind vorbei. Jetzt muss das Land seine Anstrengungen zum Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien aggressiv verstärken. Deutschlands Dominanz in der verarbeitenden Industrie und in energieintensiven Sektoren, die dem Land jahrelang ein starkes Wachstum beschert hat, führt nun dazu, dass das Land beim Energieverbrauch und bei der Umstellung auf umweltfreundlichere Alternativen hinter anderen Ländern zurückbleibt. Das Land muss sich um seine Energiesicherheit kümmern, aber eine Politik wie die Verweigerung der Laufzeitverlängerung für die verbleibenden Kernkraftwerke erscheint unklug.
- Der Welthandel hat die deutsche Wirtschaft maßgeblich vorangetrieben. Aber diese Abhängigkeit macht das Land anfällig für eine Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums. Derselbe Motor, der Deutschland zu einer Industriemacht gemacht hat, macht das Land auch anfällig für die Launen der Weltwirtschaft und des Welthandels. Heute birgt diese Konzentration auf den Handel auch ein geopolitisches Risiko. Deutschland hat von der Globalisierung profitiert, aber die Deglobalisierung könnte zu einer stärkeren regionalen Ausrichtung führen und die deutsche Wirtschaft verwundbar machen. Deutschland muss sich darauf konzentrieren, die Produktion des 21. Jahrhunderts zu schaffen, die die Welt braucht.
- Die demografische Entwicklung ist wahrscheinlich das größte Risiko für die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten der Wirtschaft. Deutschland ist mit einer alternden Bevölkerung und einem Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter konfrontiert – ein wirtschaftliches Merkmal, das alle entwickelten Volkswirtschaften teilen. Die Antwort darauf ist Zuwanderung, doch diese hat ihren politischen Preis, denn die einwanderungsfeindliche Stimmung wächst mit dem Einfluss rechtsextremer Parteien wie der AfD in Deutschland. Darüber hinaus könnten deutsche Unternehmen dem demografischen Druck durch eine verstärkte Kapitalvertiefung begegnen, bei der Technologie zunehmend Arbeit ersetzt. Das Verhältnis von Kapital zu Arbeit würde steigen, was zu einer produktiveren Wirtschaft führen könnte.
Die Gründe für die konjunkturelle Abschwächung sind vielfältig, aber insgesamt ist die Lethargie in Deutschland ein Produkt der fiskalischen Zurückhaltung, die sich negativ auf die öffentlichen Investitionen und damit auf das Wachstum ausgewirkt hat. Deutschland hat strukturelle Probleme, die nur über einen längeren Zeitraum hinweg gelöst werden können. Allerdings wurden die konjunkturellen Probleme durch diese sich seit langem abzeichnenden Strukturprobleme noch verschärft. Politische Veränderungen sind notwendig. Unter anderem müssen die Infrastrukturinvestitionen verstärkt werden, die darunter gelitten haben, dass sich die Regierung nur auf Defizite und Schulden konzentriert.
Viele der Probleme, mit denen Deutschland zu kämpfen hat, werden auch von anderen europäischen Ländern geteilt, was die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung in der Region insgesamt dämpft. In Deutschland sind die wirtschaftlichen Probleme jedoch am stärksten ausgeprägt, so dass das Land einer Rezession am nächsten ist. Hinzu kommt, dass die strukturellen Herausforderungen des Landes nicht einfach oder schnell zu bewältigen sind, so dass der zeitliche Rahmen für die Erholung Deutschlands fraglich ist.
Insgesamt bleibt Deutschland eine treibende Kraft für die wirtschaftlichen Aussichten in Europa insgesamt. Das Land ist sowohl Nachfragequelle für europäische Produzenten als auch Lieferant von Waren und Dienstleistungen für diese Länder. Als größte Volkswirtschaft in Europa trägt die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands dazu bei, dass Europa als Ganzes prosperiert. Und schließlich ist der Einfluss Deutschlands auf die Politik der Europäischen Union erheblich. Bis zu einem gewissen Grad ist die Entwicklung Europas ein Spiegelbild der Entwicklung in Deutschland.
Fußnoten:
- Quelle: A. Christenson. „Greenhouse gas emissions and other environment measures, UK and European countries: 2020.“ Office for National Statistics. 14. November 2022.
- Quelle: Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen.
- Quelle: J. Craig. „Replacement level fertility and future population growth.“ Population Trends, National Institutes of Health. 1994.
Definitionen:
Das KfW-ifo-Fachkräftebarometer berichtet über den Anteil der deutschen Unternehmen, die angeben, dass ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert wird. Jedes Quartal werden rund 9.000 Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Baugewerbe, Groß- und Einzelhandel sowie Dienstleistungen (ohne Kredit- und Versicherungsgewerbe und Staat) zu ihrer Geschäftslage befragt. Das Barometer liefert einen Gesamtindikator für den Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft, Indikatoren für verschiedene Sektoren und Regionen und Daten nach Unternehmensgröße.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keine Garantie für künftige Ergebnisse dar. Es sei darauf hingewiesen, dass eine direkte Investition in einen Index nicht möglich ist. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Renditen nicht gemanagter Indizes nicht berücksichtigt.
Beteiligungspapiere unterliegen Kursschwankungen und sind mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Festverzinsliche Wertpapiere sind mit Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie mit dem Risiko eines möglichen Verlusts des Kapitalbetrags verbunden. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren. Internationale Anlagen sind mit besonderen Risiken verbunden. Hierzu gehören Währungsschwankungen, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten, die zu erhöhter Volatilität führen können. Diese Risiken sind in Schwellenländern noch größer. Rohstoffe und Währungen sind mit erhöhten Risiken verbunden, zu denen unter anderem Marktrisiken und politische Risiken, das Regulierungsrisiko sowie Risiken im Zusammenhang mit naturgegebenen Bedingungen gehören, sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind.
US-Staatsanleihen (Treasurys) sind direkte Schuldverschreibungen, die von der US-Regierung begeben und durch ihre uneingeschränkte Kreditwürdigkeit und Steuerhoheit gesichert werden. Die US-Regierung garantiert die Kapital- und Zinszahlungen auf US-Staatsanleihen, wenn die Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Im Gegensatz zu US-Staatsanleihen werden Schuldtitel, die von Bundesbehörden und Gebietskörperschaften begeben werden, sowie damit verbundene Anlagen nicht unbedingt durch die uneingeschränkte Kreditwürdigkeit und Steuerhoheit der US-Regierung gesichert. Selbst wenn die US-Regierung die Kapital- und Zinszahlungen auf Wertpapiere garantiert, betrifft diese Garantie keine Verluste, die auf einen Rückgang des Marktwerts dieser Wertpapiere zurückzuführen sind.