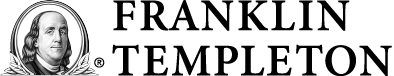Zum Jahreswechsel 2024 nehmen verschiedene Wendepunkte in der globalen Wirtschaft immer konkretere Formen an. Dazu zählen zyklische und strukturelle Faktoren.
- Der globale geldpolitische Zyklus vollzieht eindeutig eine Wende und schwenkt auf einen Senkungszyklus um. Es gibt jedoch weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen Ländern und Regionen – einige sind schon seit einigen Monaten im Senkungsmodus, andere wiederum müssen erst noch ihren Anhebungszyklus beenden. Es gibt eine bemerkenswerte Ausnahme, die sich 2024 dem erwarteten globalen Trend widersetzt, und das ist Japan. Hier rechnen wir mit weiteren Schritten in Richtung einer Normalisierung der jahrelang ultralockeren Geldpolitik.
- Die Welt scheint von einer Rezession, wie sie noch vor etwa einem Jahr befürchtet worden war, verschont geblieben zu sein und auch das Wachstum war trotz der Abkühlung besser als erwartet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in seinem jüngsten Weltwirtschaftsausblick vom Oktober erklärt, dass Aufwärtsrisiken in den Wachstumsprognosen immer plausibler werden und eine „sanfte Landung“ nunmehr im Bereich des Möglichen liege. Wie schon in den vergangenen Jahren dürften die asiatischen Länder am Rest der Welt vorbeiziehen.
- Die geopolitische Lage hat sich wie ein nicht enden wollender Schatten über die Märkte und Volkswirtschaften gelegt. Einige Faktoren wie die Spannungen zwischen den USA und China oder der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sind schon seit längerem ein Problem. Vor kurzem kam nun auch noch der Konflikt zwischen Isreal und Gaza im Nahen Osten hinzu. Die Marktrisiken, die sich aus diesen und möglichen neuen Entwicklungen ergeben, bleiben ungewiss.
- Abgesehen von potenziellen Marktrisiken infolge geopolitischer Ereignisse haben die Risse und Neuordnungen von Allianzen aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre zu strukturellen Veränderungen in den globalen Lieferketten geführt, insbesondere in Form von Reshoring und der Bildung strategischer Allianzen in bestimmten Produktionsketten. Wir gehen davon aus, dass diese Veränderungen dauerhaft sein und sich mittelfristig verstärken werden.
- Was unseren Investment-Ausblick anbelangt, gehen wir weiter von einem schwächeren US-Dollar und positiven Fundamentaldaten in einzelnen Schwellenländern sowie in Japan aus.
Der globale geldpolitische Zyklus hat seinen Höhepunkt erreicht
Die Gesamtinflation ist zurückgegangen, in vielen Fällen sogar deutlich, nachdem sie ihren höchsten Stand erreicht hatte, als Öl, Lebensmittel und andere Warenpreise durch Lieferkettenverwerfungen während der Pandemie und infolge des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine in die Höhe schossen. Da diese Kennzahl rückläufig ist, geht nun auch die Kerninflation in vielen Regionen merklich zurück. Das gibt den meisten Zentralbanken rund um den Globus die Möglichkeit, von ihrem bisherigen Straffungskurs abzurücken. Es gibt jedoch idiosynkratische Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und Regionen: Einige senken die Zinsen (wie zum Beispiel erste Notenbanken in Lateinamerika), andere legen eine Pause ein (so etwa viele Zentralbanken in den Industrieländern) und wieder andere nehmen kleinere Anhebungen vor (wie einige asiatische Notenbanken). Wir rechnen jedoch mit einer spiegelbildlichen Entwicklung des Aufwärtszyklus. Das bedeutet, dass die globale Geldpolitik im kommenden Jahr nach einer schrittweisen Entwicklung synchroner verlaufen wird als im Moment. Allgemein gehen wir davon aus, dass die Länder, die noch nicht mit der Lockerung begonnen haben, dies irgendwann im Jahr 2024 tun werden. Eine wichtige Ausnahme dürfte Japan sein. Nach unserem Dafürhalten wird sich die Reflation strukturell durchsetzen und die Bank of Japan wird von ihrem immer noch ultralockeren Kurs abrücken, um die Geldpolitik zu normalisieren.
Weiche Landung erscheint wahrscheinlicher, asiatische Schwellenländer dürften sich weiter überdurchschnittlich entwickeln
Die Wachstumsrisiken bleiben und das globale Wachstum lässt zu wünschen übrig. Die aktuellen Ergebnisse für das vergangene Jahr sind jedoch etwas besser als vom IWF Ende 2022 prognostiziert und das erwartete Worst-Case-Szenario einer globalen Rezession ist nicht eingetreten. Der IWF prognostiziert jetzt ein globales Wachstum von 2,9 % für 2024, was einem leichten Rückgang gegenüber den Wachstumsraten der Jahre 2022 und 2023 gleichkommen würde. Die asiatischen Schwellenländer dürften um 4,8 % wachsen, was gegenüber 2023 einen Rückgang darstellt, jedoch mehr ist als 2022. Wir halten einzelne Länder in Asien weiter für besonders attraktiv, insbesondere diejenigen, die solide Fundamentaldaten in Form von Leistungsbilanzüberschüssen, niedrigen Haushaltsdefiziten und geringer Verschuldung aufweisen. Einige dieser Länder werden zudem von den weltweiten Reshoring-Trends profitieren (siehe nächster Abschnitt).
Asiatische Schwellenländer übertreffen weiter das globale Wachstum
Abbildung 1: Wachstumsraten – Ist vs. Prognose
Jährliches reales Bruttoinlandsprodukt, in %, im Jahresvergleich. 2022–2024.

Quelle: Weltwirtschaftsausblick des IWF, Oktober 2023. Auf der Grundlage der aktuellsten verfügbaren Daten. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich Schätzungen, Prognosen oder Projektionen als richtig erweisen werden.
Die unterschiedlichen Auswirkungen der geopolitischen Lage
Die Welt hatte nach dem Abschwellen der Covid-Pandemie in irgendeiner Form mit einer Rückkehr zur Normalität gerechnet. Über das „New Normal“ legte sich jedoch schnell der Schatten verschiedener geopolitischer Faktoren. Die Beziehungen zwischen den USA und China waren schon vor der Pandemie angespannt. Dazu kamen erneute Spannungen im Südchinesischen Meer – wenngleich es zuletzt Bestrebungen gab, die Situation zu entschärfen.
Kaum versprachen flächendeckende Impfungen einen Ausweg aus der Pandemie, da wurde die Welt eiskalt vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine erwischt. Auf kürzere Sicht wirkte sich dies auf die Öl- und Lebensmittelpreise aus und trug zu einem Anstieg der globalen Inflationsraten bei. Diese unmittelbaren Effekte haben sich zwar verflüchtigt, aber der Krieg geht weiter und die daraus erwachsenden Risiken bleiben bestehen. Jüngst haben die Ereignisse in Israel und Gaza die Geopolitik in den Fokus gerückt. Bislang hat sich dies noch nicht markant auf die Märkte ausgewirkt, aber es wird weiterhin befürchtet, dass sich der Konflikt in der Region weiter ausweiten könnte.
Neben verschiedenen Schock auslösenden Ereignissen waren die letzten Jahre geprägt durch eine Neuausrichtung der globalen Lieferketten. Dabei geht es vor allem um das sogenannte Reshoring im Zuge von Deglobalisierungs-/Re-Regionalisierungsbestrebungen. Dazu gehören Nearshoring, Friendshoring und „China plus eins“-Strategien (also die Verlagerung von Aktivitäten oder Lieferketten in benachbarte Länder oder zu politischen Verbündeten bzw. eine Abkehr von China). Für einige Länder ergeben sich daraus Chancen, vor allem in Asien.
Auswirkungen auf den Ausblick für den US-Dollar und andere Assets
Wir gehen weiterhin davon aus, dass zyklische Faktoren (insbesondere das Ende des US-Zinsanhebungszyklus) und strukturelle Faktoren (das Doppeldefizit in Haushalt und Leistungsbilanz der USA) zu einer Dollarschwäche führen werden, wenngleich diese Entwicklung bisher ungleichmäßig verlaufen ist und es auch weiterhin bleiben dürfte. Wir gehen davon aus, dass einzelne Schwellenländer davon profitieren werden, ebenso wie Japan. Insbesondere dürfte sich für einige Länder in Lateinamerika ein Vorteil daraus ergeben, dass sie im Zinszyklus eine Führungsrolle übernommen haben. Davon abgesehen weisen bestimmte asiatische Schwellenländer solide Fundamentaldaten auf (wie oben erläutert), wobei sowohl zyklische Faktoren wie das Zinsgefälle als auch strukturelle Faktoren wie das Reshoring den Währungen dieser Länder einen weiteren Schub geben dürften. Aus struktureller Perspektive sticht Japan hervor. Wir gehen davon aus, dass der japanische Yen von der Reflation, der Normalisierung der Geldpolitik und den Reshoring-Bestrebungen – die sich die strategisch vorteilhafte geopolitische Position und Wettbewerbsvorteile im Technologiesektor, z. B. in der Robotik, zunutze machen – profitieren wird.
Zinsgefälle zwischen der US-Notenbank (Fed) und asiatischen Zentralbanken dürfte asiatischen Währungen zugutekommen
Abbildung 2: Leitzinskurs der Fed und der asiatischen Zentralbanken, nach Marktkonsens
Leitzins, in % p.a. Stand: 31. Oktober 2023.
Quelle: Bloomberg, Stand: 31. Oktober 2023. Hinweis: Asien versteht sich als der einfache Durchschnitt von sieben asiatischen Volkswirtschaften (Australien, Japan, Korea, Indien, Indonesien, Malaysia und Thailand). Zinsprognosen repräsentieren die Konsens-Prognosen von Bloomberg. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich Schätzungen, Prognosen oder Projektionen als richtig erweisen werden.
WO LIEGEN DIE RISIKEN?
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des potenziellen Verlusts des Anlagekapitals.
Festverzinsliche Wertpapiere bergen Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie das Risiko eines möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert von festverzinslichen Wertpapieren.
Internationale Anlagen sind mit besonderen Risiken verbunden. Hierzu gehören Währungsschwankungen sowie gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten, die zu erhöhter Volatilität führen können. Diese Risiken sind in Schwellenländern noch größer.
Strategien des Währungsmanagements können Verluste im Fonds verursachen, wenn sich Währungen nicht erwartungsgemäß entwickeln.